Bernhard
Peter
Historische
heraldische Exlibris (36)
Exlibris
von Oskar Roick:
Dieses undatierte
Bücherzeichen wurde entworfen von Oskar Roick
(28.3.1870-11.12.1926) für Wilhelm von Goertzke
auf Großbeuthen. Der Wappenschild in Form einer asymmetrischen
Tartsche ist in einem oben halbrund geschlossenen Innenrahmen mit
seinem Riemen schräg an einem Eichenbaum aufgehängt, rechts und
links von landwirtschaftlichem Gerät wie Spaten, Pflug, Sense,
Sichel und Harke begleitet. Das Wappen wird beschrieben im
Siebmacher Band: AnhA Seite: 23 Tafel: 13, ferner im Band: Pr
Seite: 146 Tafel: 192. Die Farben werden widersprüchlich
angegeben: Der Schild zeigt nach der ersten angegebenen Quelle in
Schwarz Kopf und Hals eines silbernen, oben mit drei
Straußenfedern, einer roten zwischen zwei silbernen, besteckten
Adlers. Nach der zweitgenannten Quelle ist die Schildfarbe
silbern, weitere Farben werden nicht gegeben. Weitere Varianten
bei v. Ledebur und bei v. Zedlitz. Im Rietstap wird die Feldfarbe
als silbern angegeben, der Adlerkopf als naturfarben. Das
Exlibris legt auch Silber als Feldfarbe nahe. Das hier nicht
dargestellte Oberwappen wäre zu schwarz-silbernen Decken das
Schildbild wachsend. Als Stammsitz der Familie wird Görtzigk bei
Gröbzig in Anhalt angegeben. Ab dem 14. Jh. ist die Familie in
der Mark Brandenburg anzutreffen. Ein berühmtes Familienmitglied
war Hans Joachim von Goertzke, kurbrandenburgischer Oberst,
General und Feldherrn unter dem Großen Kurfürsten, und ihm
gehörte Friedersdorf. Der Familie gehörte ferner Kantow,
Großbeuthen und Kleinbeuthen. Der Exlibriseigner Wilhelm von
Goertzke war der letzte Rittergutsbesitzer auf Großbeuthen.
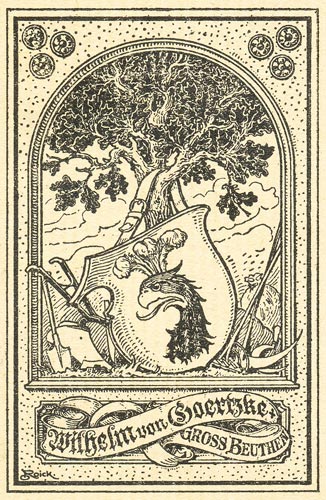
Exlibris
von Oskar Roick:
Ein heraldisches Exlibris ohne
Jahresangabe, entworfen von Oskar Roick (28.3.1870-11.12.1926)
für Graf Karl Emich zu Leiningen-Westerburg
(126 x 86 mm, Buchdruck, Witte, Bibliographie 3, 27; Gutenberg
9210). Über einem abgesetzten schmalen Schriftfeld trennt ein
vor einer knorrigen Eiche in einem verzierten Rundbogen stehender
Ritter mit Kettenhemd, Schwert und Adlerschild sowie
Adlerfähnchen an der aufrecht abgestützten Lanze zwei separate,
einander zugeneigte Vollwappen, die die beiden Stammwappen Westerburg
(in Rot ein durchgehendes goldenes Kreuz, bewinkelt von 20 (4x 5
(2:1:2)) goldenen Kreuzchen, auf dem Helm mit rot-goldenen Decken
ein schwarzer Flug, belegt mit einer roten Scheibe mit einem
durchgehenden goldenen Kreuz, dieses bewinkelt von je 5 (2:1:2)
goldenen Kreuzchen) und Leiningen (in Blau drei
(2:1) silberne Adler, auf dem Helm mit blau-silbernen Decken ein
grüner Obstbaum) repräsentieren. An dieser Stelle sei die
Abstammung des in dieser Exlibrissammlung häufiger auftretenden
Eigners gegeben:
Die Grafen von Leiningen-Westerburg, deren Bücherzeichen hier beschrieben wird, sind eigentlich vom Stamm her Herren von Westerburg. Diese wiederum sind eine aus der Stammburg im 13. Jh. verdrängte Linie der Herren von Runkel, von denen Siegfried III. von Runkel durch Heirat einer Gräfin von Leiningen die Herrschaft Westerburg und die Vogtei Gemünden erhielt. Diese Linie nannte sich nun nach ihrer neuen Burg im Westerwald erst zusätzlich, dann allein Herren von Westerburg, denn Ende des 13. Jh. trennten sich die Linien zu Runkel und zu Westerburg endgültig voneinander.
Bei den Grafen von Leiningen müssen wir die älteren Grafen und die neueren unterscheiden. Die Alt-Leininger waren seit dem Ende des 11. Jh. nachweisbare fränkische Grafen, die im Wormsgau und im Nahegau ihre Güter hatten. Sie starben um 1220 mit dem in der Manessischen Liederhandschrift abgebildeten Minnesänger Friedrich (Emich) Graf v. Leiningen aus. Danach übernahmen Abkömmlinge der Grafen von Saarbrücken deren Rolle als jüngere Grafen von Leiningen, weil die Schwester und Erbin des genannten Minnesängers, Liutgarde (Lukardis) v. Leiningen (-1239), Simon II. Graf v. Saarbrücken geheiratet hatte. Ihre Kinder sind Simon III. Graf v. Saarbrücken und Friedrich I. Graf v. Leiningen (-1237), Begründer der neuen Grafenlinie zu Leiningen. Diese Linie nahm Namen und Wappen der Leininger an und bekam aus den Saarbrücker Gütern die Herrschaft Hardenburg, und zu Beginn des 13. Jh. erbte man noch die Reichsgrafschaft Dagsburg, ein Lehen des Bischofs von Straßburg. Das Haus Leiningen teilte sich nun in eine ältere Linie Leiningen-Dagsburg und eine jüngere Linie Leiningen-Hardenburg.
Durch Erbheirat kamen die Westerburger im 15. Jh. an Namen und Wappen der Leininger. Reinhard III. von Westerburg (-22.12.1449) war seit 1422 mit Margarethe verheiratet, der Schwester des letzten Grafen Hesso von Leiningen-Dagsburg (-8.3.1467), über welche die Familie den größten Teil des Territoriums der ausgestorbenen Leininger Grafen der älteren Dagsburger Linie erhielt, und danach kombinierte Enkel Reinhard IV. Namen und Wappen und wurde Reinhard I. Graf von Leiningen-Westerburg. Diese Grafen gliederten sich wiederum in die Zweige Leiningen-Leiningen (in seinen drei Unterzweigen erloschen 1635, 1665 und 1705), Leiningen-Westerburg (erloschen 1597) und Leiningen-Schaumburg, welche sich 1695/1705 in Leiningen-Westerburg-Altleiningen (im Mannesstamm erloschen 1929 mit Gustav Friedrich Oskar, gänzlich 1974) und Leiningen-Westerburg-Neuleiningen (erloschen 1956) teilte. Zu der letztgenannten Linie gehört der Eigner des hier vorgestellten Exlibris.
Dagsburg selbst fiel 1467 an die Linie Leiningen-Hardenburg, die 1466 die lothringische Herrschaft Aspremont erworben hatte, und die sich jetzt Leiningen-Dagsburg-Hardenburg (oder -Hardenberg) nannte. Diese teilte sich 1560 in die 1779 gefürstete Linie Leiningen-Hardenburg-Dagsburg mit heutigem Sitz in Amorbach und die im Grafenstand gebliebene Linie Leiningen-Dagsburg-Falkenburg, deren unterschiedliche Zweige 1706, 1766, 1774, 1910 und schließlich 1925 mit Emich Karl Friedrich Wilhelm August Graf zu Leiningen Herr zu Billigheim (24.4.1839 -31.3.1925) als Letztem der ganzen Linie erloschen.
Es gab also parallel zwei Familien mit dem Namen Leiningen, wobei die einen von der Abstammung im Mannesstamm her Herren von Westerburg und ursprünglich von Runkel waren, die anderen ursprünglich Grafen von Saarbrücken.
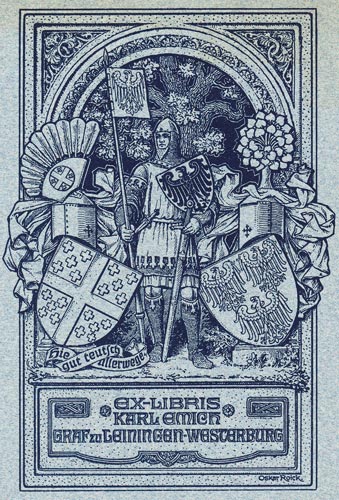

Exlibris
von Oskar Roick:
Ein weiteres Exlibris für
Otto Haak aus dem Jahr 1905, ein schwarzblauer
Buchdruck auf getöntem Papier, entworfen von Oskar Roick
(28.3.1870-11.12.1926). Das Wappen zeigt in Rot ein goldenes
Andreaskreuz, nach der Figur mit zwei schwarzen,
schräggekreuzten Feuerhaken belegt. Auf dem Helm ein goldener
Löwe wachsend zwischen einem roten Flug, einen schwarzen
Feuerhaken schräg vor sich haltend. Die Helmdecken waren 1905
bereits auf beiden Seiten rot-golden (Siebmacher, Band Bg5, S.
23, T. 27 sowie Bg7, S. 22). Das Wappen ist frontal dargestellt
und wird von einem halb knienden weiblichen Akt mit der Linken
gehalten, während die Rechte eingestemmt ist. Diese
Schildhalterin durchbricht die strenge Symmetrie der Komposition,
ist aber in sich selbst ohne Vorzugsrichtung, weil der Körper
zwar nach links gewendet ist, der gewendete Kopf aber leicht
rechts aus dem Bild heraussieht. Zusätzlich steht der Schild
noch einer Wandkonsole auf Stützen im Hintergrund auf. Die
Schildhalterin kniet halb auf einer perspektivisch leicht in
Aufsicht gezeichneten Bodenplatte, die das Feld mit der Nennung
von Eigner und Datum unten abtrennt. Das Wappen wird von einem
Oval gerahmt, welches nicht den ganzen Schild umfaßt, sondern
sich mittig hinter diesem durchzieht. Der Raum zwischen diesem
und dem rechteckigen Gesamtrahmen wird von üppigen
Kirschblütenmotiven gefüllt, die über den Rand hinausragen.
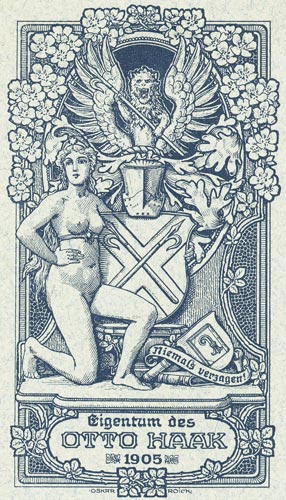

Exlibris
von Oskar Roick:
Ein rechts und links eines
Eisernen Kreuzes am unteren Blattrand die Jahreszahl 1914
tragendes heraldisches Exlibris, von der Hand des Künstlers
Oskar Roick (28.3.1870-11.12.1926), entworfen für die Familie Mylius
aus Hamburg - Othmarschen. Das Wappen Mylius zeigt in Silber die
untere Hälfte eines blauen Mühlrades, aus dessen Nabenöffnung
oben drei rote, gestielte und beblätterte Rosen hervorwachsen,
auf dem gekrönten Helm mit rot-silbernen Decken ein wachsender
roter Greif, ein Spindelrad (Teil eines Mühlengetriebes)
pfahlweise zwischen den Fängen haltend (Farben nach einem
analogen Blatt ergänzt). Zur Diskussion der Literaturstellen zu
"Mylius" vgl. das korrespondierende Blatt in der
Sammlung 39. In der unteren optisch rechten Ecke ist die Devise
zu finden: "Mit Gott muthig vorwärts". In der
gegenüberliegenden Ecke ist das Wappen der Stadt Hamburg
als Hinweis auf den beruflichen Hintergrund des Eigners zu finden
(in Rot eine silberne Burg mit drei Türmen, der mittlere Turm
mit einem Kreuz auf der Spitze, über den beiden Seitentürmen je
ein silberner Stern). Das Wappen ist eingepaßt in eine
gotisierende Ornamentik mit geschweiftem Blendspitzbogen auf zwei
Säulen, wobei die Zwickelfelder mit Eichenlaub gefüllt sind.
Eine gezinnte Brustwehr bildet den oberen Abschluß des Blattes.
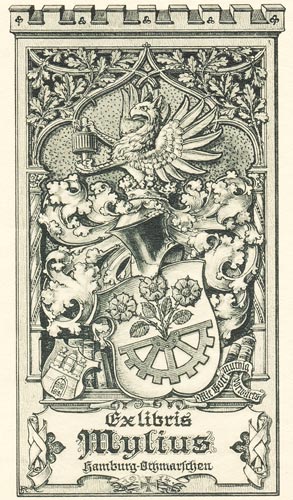

Exlibris
von Oskar Roick:
Ein undatiertes heraldisches
Exlibris, entworfen von Oskar Roick (28.3.1870-11.12.1926) für
Henry Presch aus Hamburg (Witte, Bibliographie
3, 27; Gutenberg 38.693). Mit vollständigem Namen hieß der
Eigner John Ludwig Henry Presch, und er entstammte einer
Niederlausitzer Familie, die im Landkreis Guben beheimatet war
und sich von da in der Lausitz ausbreitete. Ein Zweig der
Groß-Drenziger Linie breitete sich zu Beginn des 19. Jh. nach
Hamburg aus, und dieser entstammte der Eigner, ein Nachfahr des
Johann Martin Presch, gest. 8.8.1830, welcher die Hamburger Linie
begründete. Die Künstlersignatur ist sehr versteckt; sie ist an
der Pfeilerbasis unter dem Adler am optisch rechten Bildrand zu
finden. Auf der Brüstung vor einer rund ausgeschnittenen Vedoute
des Hamburger Stadtbildes (der Eigner wohnte in der
Katharinenstraße 36) sitzt eine Hermesfigur, nur mit einem
Hüfttuch bekleidet, auf dem Kopf den geflügelten Helm, in der
Linken den von zwei sich anblickenden Schlangen umwundenen
Flügelstab, den rechten Unterarm auf den Schild gelegt, ein sehr
lässiger Schildhalter. Der linke der beiden in geflügelten
Sandalen steckenden Füße ist auf einem mit dem Monogramm HP
für den Eigner gezeichneten Warenballen abgestützt, der rechte
auf einem Quaderstein. Neben dem Wappen ist ein Anker mit um den
Schaft gewundener Kette zu sehen. All das illustriert das
berufliche Umfeld des Kaufmanns Henry Presch. Das Wappen Presch,
im Siebmacher Band: Bg13 Seite: 33 Tafel: 23 unter Bezugnahme auf
genau dieses Exlibrisblatt mit den hier wiedergegebenen
genealogischen Angaben beschrieben, zeigt in Rot eine goldene
Birke mit schwarz-silbernem Stamm, auf goldenem Boden wachsend,
überdeckt von einem silbernen Schräglinksbalken. Auf dem
rot-silbern bewulsteten Helm mit rot-silbernen Decken vor einem
goldenen Ährenbündel schräggekreuzt ein schräglinks gelegter
silberner Anker und ein schrägrechts gelegtes, silbernes,
goldengegrifftes Schwert, verschränkt mit einer aufgerichteten,
mit der Schneide nach rechts gerichteten, rot gegrifften,
silbernen Sichel. Der Eigner beschäftigte sich intensiv mit der
Familiengeschichte und verfaßte einige Publikationen dazu,
worauf die Rückenbeschriftung der neben dem Hermes aufgestellten
Bücher Bezug nimmt. Zwei weitere Wappenschilde in den oberen
beiden Ecken mit Regionalbezug ergänzen die Komposition,
heraldisch oben rechts ist der gewendete Schild der Markgrafschaft
Niederlausitz, in Silber ein schreitender, roter Stier,
gegenüber das Wappen der Stadt Hamburg, in Rot
eine silberne Burg mit drei Türmen, der mittlere Turm mit einem
Kreuz auf der Spitze, über den beiden Seitentürmen je ein
silberner Stern. Die Devise unterhalb des Familienwappens lautet:
"Treu in Pflicht, wahr in Rat, fest in Tat".
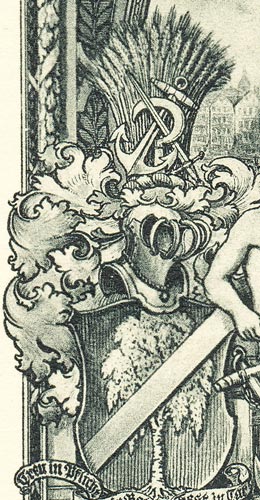
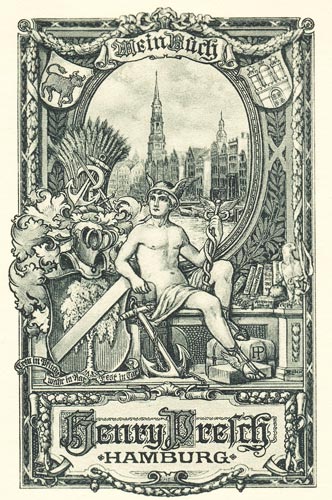
Exlibris
von Oskar Roick:
Ein undatiertes heraldisches
Exlibris, entworfen von Oskar Roick (28.3.1870-11.12.1926) für
Heinrich Theodor von Kohlhagen (30.4.1885-18.4.1918).
Das unten rechts im Druck signierte Blatt enthält größtenteils
eine Szene voller Ritterromantik, gerahmt von einem oben halbrund
geschlossenen Rahmen mit Rosenzweigen in den Zwickeln. Im
Hintergrund liegt eine Burg mit Turm, einem Turmhaus mit
romanischen Zwillingsfenstern im ersten Geschoß und einem
darüberliegenden Wehrgeschoß mit nach außen klappbaren
Holzläden, auf Maschikulis vorkragend, links führt eine
Steinbrücke über einen Graben zum verschlossenen Burgtor,
darüber eine offene Galerie. Die Ecke wird von zwei
Strebepfeilern verstärkt. Aus dem rechts im Hintergrund
befindlichen Wald reitet ein Gerüsteter, eine nicht zum
Familienwappen passende Helmzier auf einer Schaller befestigt,
eine Lanze in der Rechten senkrecht emporhaltend. Eine Tartsche
mit Lanzenruhe ist am linken Oberarm befestigt. Auch das Pferd
ist an Brust, Kopf, Nacken und Hinterteil schwer gepanzert; das
Zaumzeug ist besonders prächtig gestaltet, man beachte
insbesondere die breiten, bandartig verzierten Zügel. Das
Familienwappen im optisch linken unteren Eck, einwärts gewendet,
wird angesichts dieses prächtigen Aufzuges fast zur Nebensache.
Der Schild ist golden-blau gespalten, rechts ein
rechtsaufspringender roter Löwe, links ein mit drei roten Rosen
belegter silberner Schräglinksbalken, hier komplett gespiegelt
(vgl. Siebmacher Band: Bay Seite: 90 Tafel: 106). Auf dem
gekrönten Helm mit blau-silbernen Decken ein wachsender roter
Löwe zwischen einem blauen Flug, jeder Flügel mit dem mit drei
roten Rosen belegten silbernen Schrägbalken belegt, rechts
schräglinks, links schrägrechts. Des Eigners Vorfahr Theodor
Kohlhagen, königlich-bayerischer Landrichter zu Nürnberg, war
am 27.4.1825 von König Max I. von Bayern in den Adelsstand
erhoben worden. Der Eigner selbst, bekannt als aus Nürnberg
stammender Heraldiker, Genealoge und Historiker und Autor
zahlreicher Fachpublikationen (vor allem in den
heraldisch-genealogischen Blättern des Vereins St. Michael, z.
B. über Nürnberger Geschlechterwappen, über die Geschichte der
heraldischen Helme, über den Uradel Altbayerns, über die
Familie Oelhafen, aber auch über Burgen wie Burg Freyenfels und
Schlösser wie Dennenlohe), war der Sohn von Theodor Wilhelm
Arnold Philipp von Kohlhagen, königlich-bayerischer
Bahn-Ober-Expeditor, und dessen Frau Christine Friederike Therese
Oelhafen von und zu Schoellenbach. Sein Forschungsschwerpunkt war
Franken, insbesondere Nürnberg (wo im GNM sein Nachlaß
aufbewahrt wird) und Bamberg sowie die Oberpfalz. Er zählt zu
den Gründern des Vereines St. Michael (Verein deutscher
Edelleute) im Jahre 1905.
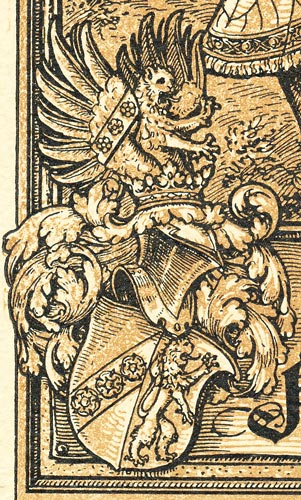
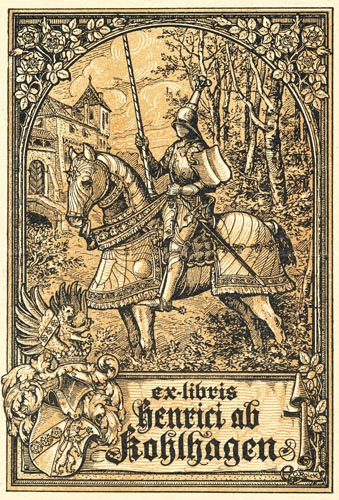
Exlibris
von Adolf M. Hildebrandt:
Ein heraldisches Exlibris aus
dem Jahre 1890, entworfen von Adolf M. Hildebrandt
(16.6.1844-30.3.1918) für die Bibliothek des Neufville'schen
Familien-Archivs zu Frankfurt am Main (107 x 76 mm, Buchdruck,
Witte, Bibliographie 2, 35; Thieme-Becker 17; Gutenberg 4222;
Leiningen-Westerburg 47). Das zentrale Vollwappen der de
Neufville zeigt einen roten, mit einem goldenen, von
vier silbernen Zinnentürmen bewinkelten Schragen (Andreaskreuz)
belegten Schild, in der Mitte belegt mit einem blauen Stockanker.
Auf dem Helm mit rot-goldenen Decken ein wachsender goldener
Greifenrumpf mit rechtem goldenem und linkem rotem Flügel und
roter Zunge. Die Devise lautet: NE VILE VELIS. In den beiden
unteren Ecken werden Varianten des Wappenschildes abgebildet,
alle nach heraldisch rechts geneigt, rechts unten das Wappen wie
beschrieben, aber ergänzt mit einem silbernen rechten Obereck
mit einer roten aufrechten Hand, die sog. "Red Hand of Ulster", ein Zeichen
eines Baronets in der englischen Heraldik. Das erstaunt bei einer
in Frankfurt verwurzelten Familie, doch Sir
Robert de Neufville (1670-1735) wurde am 18.3.1709 oder 1711 je
nach Quelle englischer Baronet, erster, einziger und letzter
dieses Namens. Der Schild gegenüber zeigt eine andere Variante
des Familienwappens, wie oben beschrieben, darauf ein blauer
Herzschild mit einem aufrechten, silbernen Stockanker. Ein
weiterer Schild oben rechts ist golden mit einem roten,
verflochtenen Schräggitter (Rietstap gibt "d'or fretté de
gueules" als älteres Wappen der de Neufville
zu Amsterdam an und das mit den Türmen als neueres Wappen),
gegenüber ein roter mit einem goldenen Schragen (so ein Wappen
führte laut Rietstap die Familie Neufville gen. Mensart,
die ebenfalls wie die anderen de Neufville ursprünglich aus dem
Artois stammt, "de gueules au sautoir d'or"). Die aus
dem Artois kommend über Belgien und die Niederlande schließlich
nach Deutschland eingewanderte Frankfurter Bankiersfamilie wird
ausführlich in der Exlibris-Sammlung 20 diskutiert.
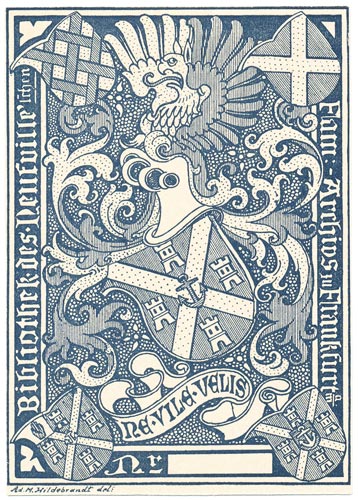
Exlibris
von Adolf M. Hildebrandt:
Ein relativ kleines und in
seiner Detailfülle im Druck schlecht aufgelöstes heraldisches
Exlibris aus dem Jahr 1893, entworfen von Adolf M. Hildebrandt
(16.6.1844-30.3.1918) für den Bankier Alfred von Neufville
(1856-1900) aus Frankfurt am Main, aus der gleichen Familie wie
zuvor (52 x 37 mm, Witte, Bibliographie 2, 35; Thieme-Becker 17;
Gutenberg 25.668; Leiningen-Westerburg 39). Das zentrale
Vollwappen der de Neufville zeigt einen roten,
mit einem goldenen, von vier silbernen Zinnentürmen bewinkelten
Schragen (Andreaskreuz) belegten Schild, darauf ein blauer
Herzschild mit einem aufrechten, silbernen Stockanker. Auf dem
gekrönten Helm mit rot-goldenen Decken ein wachsender goldener
Greifenrumpf mit roten Flügeln und roter Zunge. Man beachte die
unterschiedliche Tingierung der Flügel im Vergleich zu dem
vorherigen Blatt. Die Devise lautet: NE VILE VELIS. Hier ist die
Ausführung besonders prunkvoll mit zwei goldenen, rot
geflügelten Greifen als Schildhaltern und zwei an Lanzen
befestigten Fähnchen hinter dem Wappen, beide zeigen in Gold ein
rotes, verflochtenes Schräggitter, welches Rietstap als das
ältere Wappen der de Neufville angibt, welches hier als
Zusatzmotiv eingebaut wird. Das Wappen der Neufville wird
beschrieben im Siebmacher Band: Frkft Seite: 8 Tafel: 8, Band: Pr
Seite: 56 Tafel: 72, Band: Pr Seite: 279 Tafel: 330, Band: PrE
Seite: 140 Tafel: 119, Band: PrE Seite: 212 Tafel: 184, Band: Na
Seite: 7 Tafel: 8, ferner im Rietstap (siehe dort auch: van
Gelder de Neufville). Auch hier sei auf die ausführliche
Diskussion in der Exlibris-Sammlung 20 verwiesen.

Dieses Blatt gibt es in einer weiteren Variante, mit genau der gleichen Grundgraphik, aber mit einer anderen Jahreszahl, nämlich 1889, und mit einer erweiterten Beschriftung: "Alfred von Neufville Jähenberg Villa Anna Eppstein i/T." Die Neufville-Anlage mit dem 10 ha großen Bergpark Villa Anna liegt in der Stadt Eppstein auf dem Jähenberg und wurde von dem Bankier Albert von Neufville ab 1884 angelegt. Das Haupthaus nannte er "Villa Anna" nach seiner Ehefrau Anna Mumm von Schwarzenstein (1860-), der Tochter von Daniel Heinrich Mumm von Schwarzenstein, Oberbürgermeister von Frankfurt. Neben dem Haupthaus entstanden noch weitere Gebäude, ein Schweizer Haus, ein Gartenhaus, ein Taubenhaus, eine Meierei, drei Häuser im Landhausstil mit Fachwerk, ein Kutscherhaus und ein Gästehaus und noch den Neufville-Turm. Den Park legte Andreas Weber an, der auch die Gartenanlagen des Frankfurter Zoos gestaltete. 1933 verkauften die Erben ein Drittel der Anlage an die Stadt Eppstein und zwei Drittel an die Evangelische Kirche Hessen, der 1981 an die Jugendberatung und Jugendhilfe Frankfurt verkauft wurde. Heute wird in der Villa die Stationäre Jugendhilfe Villa Anna betrieben.
 |
 |
Exlibris
von Adolf M. Hildebrandt:
Auch dieses undatierte
Exlibris fertigte Adolf M. Hildebrandt (16.6.1844-30.3.1918) für
das Neufville'sche Familienarchiv in Frankfurt
am Main an. Im Gegensatz zu den beiden vorherigen Aufrissen wurde
die runde Form gewählt, wobei der Rand mit dem Schriftzug
innerhalb einer doppelten Schmuckleiste von den beiden den Schild
haltenden Greifen überschnitten wird. Das Wappen folgt dem oben
Gesagten. In diesem dritten Blatt wird wie im ersten, jedoch
anders als im zweiten, der Anker direkt und ohne Herzschild dem
Zentrum des Schildes aufgelegt. Neu im Vergleich zu den anderen
bisher in dieser Sammlung vorgestellten Zeichnungen ist das
Auftauchen der Devise auf einem zweiten, sich unter dem Schild
und unter den Schildhaltern windenden Schriftbandes mit dem
Wortlaut "Mon désir tend à la Neufville". Das Blatt
ist im Druck unterhalb des "f" von
"Neufville" monogrammiert mit der typischen AH-Ligatur.
Ganz unten zwischen diesem Schriftband und der kreisförmigen
Einfassung hat der Künstler einen Bereich für die individuelle
Buchsignatur gelassen.
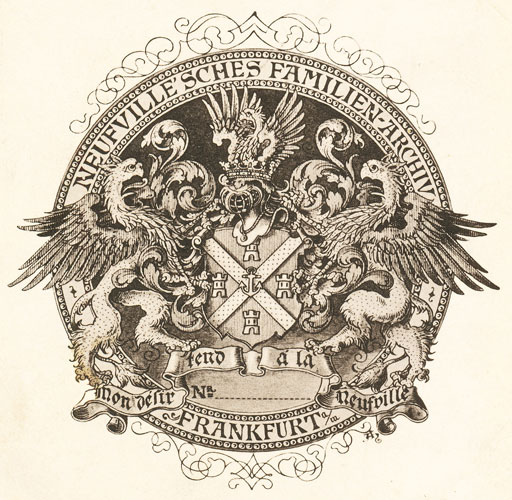 |
 |
Exlibris
von Alexander von Dachenhausen:
Ein heraldisches Exlibris aus
dem Jahr 1900, entworfen von Alexander von Dachenhausen
(5.9.1848-3.11.1916) zu Wien für "Alfr(ed) Frhrn. v.
Dachenhausen Beamter D(er) Privil(egierten)
Oest(erreichisch-).Ung(arischen). Staats-Eisenb(ahn).
Ges(ellschaft)." (115 x 105 mm, Buchdruck, Witte,
Bibliographie 1, 144; Thieme-Becker 8; nicht bei Gutenberg). Das
Künstlermonogramm befindet sich optisch rechts neben den Zipfeln
der linken Helmdecke. Dieses Blatt ist eines von mehreren des
Künstlers, die in radikaler Klarheit geometrische Formen der
Gotik als Rahmen für ein im frühen Stil dargestelltes Wappen
verwenden, wobei hier im Rahmen aus sich überlagerndem
Rundbogen-Dreipaß und Dreieck ganz im Stile früher gotischer
Helmsiegel nur der Helm mit Helmzier wiedergegeben wird, was
dadurch möglich ist, daß die Helmzier ein Hilfskleinod ist,
welches das Schildbild aufgreift, so daß jenes unterschlagen
werden kann. Der nicht dargestellte Schild der Freiherren von Dachenhausen
wäre unter rotem Schildhaupt silbern-schwarz geschacht. Hier
sehen wir nur den Helm mit - äußerst reduzierten -
schwarz-silbernen Decken und auf demselben ein wie der Schild
bezeichneter, hier offener Adlerflug (Beschreibung im Siebmacher
Band: Han Seite: 19 Tafel: 21 und PrE Seite: 45 Tafel: 37, ferner
im alten Siebmacher von 1605 und im Geschlechts- und Wappenbuch
des Königreichs Hannover und des Herzogtums Braunschweig von Dr.
H. Grote). Der Eigner wohnte während seiner Wiener Zeit 1881 in
der Neudeggergasse 10. Sein Lebenslauf ist von diversen
Positionen beim Militär und in der Zivilverwaltung geprägt,
erst sieht man ihn seit 1864 im einem hannoverschen
Kadettencorps; als Leutnant nahm er 1866 an der Schlacht von
Langensalza teil. Danach studierte er Geschichte und
Nationalökonomie in Göttingen. Der Krieg 1870/71 rief ihn
wieder unter die Fahnen Preußens als Offizier, aus diesem Krieg
kehrte er als Invalide zurück. 1876 war er preußischer Leutnant
a. D. Neben diversen Posten in der Zivilverwaltung widmete er
sich nun besonders den heraldisch-genealogischen Forschungen und
war u. a. 1880-1894 als Redakteur des Genealogischen Taschenbuchs
der Adeligen Häuser tätig. 1903-1908 war er Archivar in
Brüssel in Diensten des Herzogs von Arenberg.
August Otto Albert Friedrich Georg Alexander von Dachenhausen (5.9.1848-3.11.1916), der Künstler, war der Sohn von Friedrich Bernhard von Dachenhausen (26.4.1813-18.9.1873), Major in Hannover, und Karoline Auguste Dorothee Elise Plathner (14.11.1827-21.11.1908). Die Eltern hatten am 20.10.1846 in Göttingen geheiratet. Alexanders Bruder, Alfred oder ausführlich Alfred Eduard Friedrich von Dachenhausen (12.12.1849-), technischer Beamter der österreichischen Staatseisenbahn in Wien, hatte am 22.8.1899 in Prag die aus Mühlhausen in Böhmen stammende Beatrix Helena Katherina Chlapetz (14.1.1876-) geheiratet. Esterer ist der Exlibris-Eigner. Auch für seine Frau hat der Künstler ein Exlibris angefertigt (siehe nächster Teil der Sammlung). Eine Komplett-Zusammenschau aller für seine Verwandten von diesem Künstler erstellten Exlibris ist im Kapitel Exlibris 82 zu finden.

Exlibris
von Ernst Krahl:
Ein heraldisches Exlibris ohne
Datierung, entworfen von Ernst Krahl (26.10.1858-22.11.1926) für
die Familie von Hubka (100 x 51 mm, vierfarbiger
Rasterdruck, Witte, Bibliographie 2, 127; Thieme-Becker 21; nicht
bei Gutenberg). Das Geschlecht der von Hubka stammt ursprünglich
aus Böhmen. Der Schild zeigt in Blau eine silberne
Schräglinksleiste, begleitet von fünf (2:3) entlang der Figur
pfahlweise gestellten, silbernen, golden gegrifften Schwertern.
Auf dem gekrönten Helm mit blau-silbernen Decken fächerförmig
fünf nach links wehende, dreieckig geschnittene Fähnchen in den
Farben blau-silbern-blau-silbern-blau an golden geschäfteten
Turnierlanzen mit silbernen Spitzen, die Schwenkel jeweils um die
Stange geschlungen. Das Wappen findet sich weder im Siebmacher
noch im Rietstap. In dieser Form ist das auch nicht das
ursprüngliche Wappen der Familie. Seit 1506 führten sie in Blau
einen mit drei goldenen Sternen belegten Schrägbalken,
beiderseits besteckt mit zwei gegeneinander gekehrten roten
Lilien und auf dem Helm mit blau-roten Decken einen wie der
Schild bez. Adlerflügel (Wappenbrief vom 4.7.1506, ausgestellt
zu Ofen). Das Wappen blieb auch noch so, als Gustav Hubka 1895
den altböhmischen Ritterstand mit dem Zusatz "von
Czernczitz" anerkannt bekam, was 1905 widerrufen wurde. 1917
wurde das Wappen radikal zu der hier gezeigten Form geändert,
wobei allenfalls noch die Farbe Blau vom alten Wappen übrig
blieb. Das entsprechende Diplom datiert vom 8.12.1917, die
Begünstigten waren die Söhne des obengenannten Gustav Hubka
(Gustav, Heinrich, Karl und Alfred, allesamt als Offiziere beim
Militär dienend) und dessen Witwe Josephine. Unter dem Schild
zieht sich das Schriftband mit der Devise entlang: "Preis
Gott allzeit". Damit liegt die Entstehungszeit des Blattes
zwischen 1917 und 1926. Das Wappenmotiv selbst bedingt eine
unbefriedigende Platzaufteilung, die Kombination der schmalen
senkrechten Elemente mit dem Schräglinksbalken verschenkt viel
Platz und überzeugt gestalterisch nicht. Dieser konzeptionelle
Fehler ist der Hofkanzlei anzulasten, nicht dem aufreißenden
Künstler, dessen Virtuosität sich bei der Gestaltung der Decken
und der Helmzier zeigt.


Literatur,
Quellen und Links:
Elke Schutt-Kehm,
Exlibris-Katalog des Gutenberg-Museums, 2. Teil, Band 1: A-K, 720
Seiten, 1685 Abb., Verlag Claus Wittal, Wiesbaden, 1998, ISBN
978-3-922 835-31-8.
Elke Schutt-Kehm, Exlibris-Katalog des Gutenberg-Museums, 2.
Teil, Band 2: L-Z, 736 Seiten, 1795 Abb., Verlag Claus Wittal,
Wiesbaden, 1998, ISBN 978-3-922 835-32-5
Claus Wittal, Eignerverzeichnis zum Exlibris-Katalog des
Gutenberg-Museums, Verlag Claus Wittal, 2003, 336 Seiten, 595
Abb., ISBN 978-3-922 835-33-2
Siebmachers Wappenbücher
Rietstap/Rolland
Genealogien: Prof. Herbert Stoyan, Adel-digital, WW-Person auf
CD, 10. Auflage 2007, Degener Verlag ISBN 978-3-7686-2515-9
Leiningen: http://de.wikipedia.org/wiki/Leiningen-Westerburg
Genealogien Leiningen-Westerburg: http://genealogy.euweb.cz/runkel/runkel2.html,
Genealogien Leiningen-Westerburg: http://de.wikipedia.org/wiki/Stammliste_des_Hauses_Runkel,
Genealogien Leiningen Westerburg: http://de.wikipedia.org/wiki/Stammliste_des_Hauses_Leiningen-Westerburg
Gerhard Köbler: Historisches Lexikon der deutschen Länder - die
deutschen Territorien vom Mittelalter bis zur Gegenwart. C. H.
Beck Verlag München 7. Auflage 2007, ISBN 978-3-406-54986-1, S.
365-369, S. 779
Leiningen: http://de.wikipedia.org/wiki/Leiningen-Westerburg,
Leiningen: http://www.deutsche-biographie.de/xsfz50010.html
Herrschaft Westerburg: http://de.wikipedia.org/wiki/Herrschaft_Westerburg
Leiningen-Westerburg: Siebmachers Wappenbücher Band Gf, Seite:
20-24, Tafel: 39-52 etc.
Johann Georg Lehmann, Geschichte und Genealogie der Dynasten von
Westerburg aus Urkunden und anderen archivalischen Quellen,
Verlag Roth, Wiesbaden 1866, http://books.google.de/books?id=0JVAAAAAcAAJ
Lebenslauf A. v. Dachenhausen und H. v. Kohlhagen: Siebmachers
großes Wappenbuch, Sonderband H: Jürgen Arndt: Biographisches
Lexikon der Heraldiker; 1992. XXIV und 664 S. mit zahlr.
Wappenabb., Festeinband, Degener Verlag, ISBN 3-87947-109-6
Besitzungen der von Goertzke: http://www.kulturverein-grossbeuthen.de/Veranstaltungen.html
Hubka: Monographie über die Familie http://www.coresno.com/aktuell/61-kategorie-beitraege/3343-lex-hubka-1917.html
Hubka: Wiener Genealogisches Taschenbuch Bd. 1, 1926, S. 108; Bd.
6, 1934, S. 82, Bd. 8, 1937, S. 85.
Hubka: Genealogisches Handbuch des Adels, Adelslexikon, Bd. 5,
1984, S. 398.
H. v. Kohlhagen, Publikationen: http://opac.regesta-imperii.de/lang_en/autoren.php?name=Kohlhagen%2C+Heinrich+Theodor+von
Neufville: http://www.leighrayment.com/baronetage/baronetsD1.htm - http://books.google.de/books?id=Q6D1BnVPg48C.......e
Genealogie Alexander und Alfred von Dachenhausen: http://www.woydt.be/genealogie/g18/g181/1813vdfr01.htm
Villa Anna: https://de.wikipedia.org/wiki/Bergpark_Eppstein
Exlibris (01) - (02) - (03) - (04) - (05) - (06) - (07) - (08) - (09) - (10) - (11) - (12) - (13) - (14) - (15) - (16) - (17) - (18) - (19) - (20)
Exlibris (21) - (22) - (23) - (24) - (25) - (26) - (27) - (28) - (29) - (30) - (31) - (32) - (33) - (34) - (35) - (36) - (37) - (38) - (39) - (40)
Exlibris (41) - (42) - (43) - (44) - (45) - (46) - (47) - (48) - (49) - (50) - (51) - (52) - (53) - (54) - (55) - (56) - (57) - (58) - (59) - (60)
Exlibris (61) - (62) - (63) - (64) - (65) - (66) - (67) - (68) - (69) - (70) - (71) - (72) - (73) - (74) - (75) - (76) - (77) - (78) - (79) - (80)
Französische Exlibris (1) - (2) - (3) - (4) - Italienische Exlibris (1) - belgische Exlibris (1) - portugiesische Exlibris (1)
Britische Exlibris (1) - (2)
- (3) - (4) - (5)
- (6) - (7) - (8)
- (9) - (10) - (11)
- (12) - (13) - (14)
- (15) - (16)
spanische Exlibris (1)
Signaturen von Künstlern und Heraldikern
©
Copyright / Urheberrecht am Text und Datenbank: Bernhard Peter
2012
Die Abb. sind selbst angefertigte Scans historischer, aufgrund
ihres Alters gemeinfreier Originale.
Sofern bekannt, ist der Urheber bei der jeweiligen historischen
Graphik angegeben.
Impressum