
Bernhard
Peter
Galerie:
Photos schöner alter Wappen Nr. 3169
Meisenheim (Landkreis Bad Kreuznach)

Die
ev. Schloßkirche in Meisenheim: Grabkapelle (Gruftkapelle) der
Pfalzgrafen
Im Laufe der Zeit wurden 44
Angehörige des Hauses Wittelsbach in der Meisenheimer
Schloßkirche beigesetzt. Die alte Stephansgruft unter dem
Mittelschiff reichte längst nicht mehr aus, so daß bereits
Ludwig der Schwarze eine neue Gruft anlegen ließ, die nach ihm
als Ludwigsgruft bezeichnet wird. Der Zugang zum Gruftgewölbe
befindet sich in der Gruftkapelle am östlichen Ende des
südlichen Seitenschiffs. Er wird abgedeckt von einer mit
eisernen Ringen versehenen Sandsteinplatte, auf der das bronzene
Wappen des Hauses Pfalz-Zweibrücken befestigt
ist. Dieses Kunstwerk ist relativ jungen Datums, denn es wurde
erst 1896 auf Veranlassung Kaiser Wilhelms II. und des
bayerischen Prinzregenten Luitpold geschaffen und deckt seitdem
den Grufteingang ab.
Der Schild ist gespalten,
rechts geviert mit Herzschild, Feld 1 und 4: Pfalzgrafschaft
bei Rhein, in Schwarz ein goldener Löwe, rot gekrönt,
gezungt und bewehrt, Feld 2 und 3: Herzogtum Bayern,
Haus Wittelsbach, silbern-blau
schräg gerautet, Herzschild: Grafschaft Veldenz,
in Silber ein blauer Löwe, golden bewehrt und golden gekrönt,
links geteilt und zweimal gespalten, Feld 1: Herzogtum
Jülich, in Gold ein schwarzer Löwe, Feld 2: Herzogtum
Kleve, in Rot mit silbernem Herzschild ein
goldenes Glevenrad, Feld 3: Herzogtum Berg,
in Silber ein roter Löwe, golden bewehrt, blau gekrönt, Feld 4:
Grafschaft Mark, in Gold ein
silbern-rot geschachter Balken, Feld 5: Grafschaft
Ravensberg, in Silber drei rote Sparren, Feld 6:
Grafschaft Moers, in Gold ein
schwarzer Balken. Wie der Schild, so unterstreichen auch die
insgesamt fünf Helme den Erbanspruch auf die Vereinigten
Herzogtümer im Kleve-Jülicher Erbfolgestreit: Helm 1 (Mitte): Herzogtum
Pfalz-Bayern (1), zwischen einem blau-silbern
schräggerauteten Paar Büffelhörner, normalerweise noch an den
Seiten und in den Mundlöchern mit goldenen Lindenzweiglein
besteckt, ein golden gekrönter und rot bewehrter goldener
Pfälzer Löwe, Helm 2 (rechts innen): Herzogtum Jülich,
der Rumpf eines wachsenden goldenen Greifen mit schwarzen
Flügeln, rot bewehrt, mit rotem Halsband, auf ungekröntem Helm,
Helm 3 (links innen): Herzogtum Kleve, ein in
den Helmkopf beißender, roter Büffelkopf mit silbernen Hörnern
und Krone, Helm 4 (rechts außen): Herzogtum Pfalz-Bayern
(2), zwischen einem eigentlich noch mit blau-silbernen
schrägen Rauten belegten Adlerflug ein rotbewehrter, rot
gekrönter goldener Pfälzer Löwe auf gekröntem Helm, Helm 5
(links außen): Herzogtum Berg, ein natürlicher
Pfauenstoß auf gekröntem Helm, Helmdecken rot-silbern.

In der über der Ludwigsgruft gelegenen
Grabkapelle sind insgesamt 6 Epitaphien aufgestellt bzw. an der
Wand angebracht, davon ein Doppel-Epitaph. Im wesentlichen sind
es ein Ehepaar, drei seiner Kinder, ein Urenkel und eine
Ururenkelin, an die hier mit exquisiten Grabmonumenten erinnert
wird. Alle diese Epitaphien enthalten neben dem oder den
Hauptwappen jeweils acht Ahnenwappen. Und alle bilden stilistisch
eine Einheit, weil sie in engem zeitlichen Rahmen entstanden sind
und größtenteils aus der selben Werkstatt-Tradition stammen,
bis auf einen späten Ausreißer, der sich aber harmonisch in den
Gesamtkomplex einfügt und kaum von dem vorgegebenen Schema
abweicht. Die Zusammenhänge zwischen den Epitaphien bzw.
Personen illustriert folgende genealogische Übersicht:
- Ludwig I. Pfalzgraf bei Rhein zu
Zweibrücken Herzog von Bayern (1424-19.7.1489), beigesetzt in der
Fürstengruft der Meisenheimer Schloßkirche, vermählt mit Jeanne de Croy (-18.6.1504),
Ehewappen am
Netzgewölbe der Gruftkapelle, beide Wappen an den
Gewölbekonsolen im Chor, der
Tochter von Antoine I. de Croy Comte de Porcean et de
Guines (-1475) und Margaretha von Lothringen-Vaudemont
(-1521)
- Alexander Pfalzgraf bei Rhein
zu Zweibrücken Herzog von Bayern
(26.11.1462-1514), beigesetzt in der Zweibrücker
Alexanderskirche,
vermählt mit Margareta von
Hohenlohe-Waldenburg-Neuenstein
(30.7.1480-3.9.1522), der Tochter von Kraft VI.
von Hohenlohe-Waldenburg-Neuenstein und Helene
von Württemberg
- Ludwig II. Pfalzgraf
bei Rhein zu Zweibrücken Herzog von
Bayern (14.9.1502-3.12.1532), beigesetzt
in der Zweibrücker Alexanderskirche, vermählt mit Elisabeth
von Hessen (10.9.1503-4.1.1563), der
Tochter von Wilhelm I. Landgraf von
Hessen (4.7.1466-8.2.1515) und Anna von
Braunschweig-Wolfenbüttel (-16.5.1520)
- Wolfgang
Pfalzgraf bei Rhein zu
Zweibrücken Herzog von Bayern
(26.9.1526-11.6.1569), bekam
bei der Nachfolgeregelung der
Kurpfalz die Hälfte der Hinteren
Grafschaft Sponheim und die
Herrschaft Neuburg an der Donau, 1532 zu
Zweibrücken, 30.6.1557 Kauf der
"jungen Pfalz", 1559 zu
Neuburg und Sulzbach, 1566 zu
Sponheim, vermählt mit Anna
von Hessen
(26.10.1529-1591),
Doppelepitaph in der Gruftkapelle
Meisenheim, der Tochter von
Philipp I. Landgraf von Hessen
(13.11.1504-31.3.1567) und
Christina von Sachsen
(25.12.1505-15.4.1549)
- Christine
Pfalzgräfin bei Rhein zu
Zweibrücken-Neuburg
(29.2.1546-12.3.1619),
unvermählt und
kinderlos, Epitaph in
der Gruftkapelle
Meisenheim
- Anna
Pfalzgräfin bei Rhein zu
Zweibrücken-Neuburg
(2.6.1554-13.11.1576),
unvermählt und
kinderlos, Epitaph in
der Gruftkapelle
Meisenheim
- Karl
Pfalzgraf bei Rhein zu
Zweibrücken-Birkenfeld
Herzog von Bayern
(4.9.1560-6.12.1600), Epitaph in
der Gruftkapelle
Meisenheim, Begründer
der Linie zu Birkenfeld, 1569 zu
Birkenfeld, 1584 Ererbung
von Hinter-Sponheim mit
Birkenfeld, vermählt
1586 in Celle mit
Dorothea von
Braunschweig-Lüneburg-Celle
(1.1.1570-15.8.1649), der
Tochter von Wilhelm V.
Herzog von
Braunschweig-Lüneburg-Celle
(4.7.1535-1592) und
Dorothea von Dänemark
(1546-1617)
- Georg
Wilhelm Pfalzgraf bei
Rhein zu
Zweibrücken-Birkenfeld
Herzog von Bayern
(26.8.1591-25.12.1669)
- Sophia
Pfalzgräfin bei Rhein zu
Zweibrücken-Birkenfeld
(29.3.1593-16.11.1676)
- Friedrich
Pfalzgraf bei Rhein zu
Zweibrücken-Birkenfeld
(29.10.1594-20.7.1626)
- Christian
I. Pfalzgraf bei Rhein zu
Birkenfeld-Bischweiler
Herzog von Bayern
(3.9.1598-6.9.1654)
- Philipp
Ludwig Pfalzgraf bei
Rhein zu
Zweibrücken-Neuburg
Herzog von Bayern
(2.10.1547-22.8.1614), Begründer
der Linie Pfalz-Neuburg
- Johann
I. Pfalzgraf bei Rhein zu
Zweibrücken Herzog von
Bayern (1550-12.8.1604), bekam
das Herzogtum
Pfalz-Zweibrücken, beigesetzt
in der Zweibrücker
Alexanderskirche, vermählt
mit Magdalena Herzogin
von Cleve
(1553-30.8.1633), der
Tochter von Wilhelm V.
Herzog von Cleve, Jülich
und Berg Graf von der
Mark und von Ravensberg
(28.7.1516-1592) und
Maria von Österreich
(15.5.1531-11.12.1581)
- Johann
II. Pfalzgraf bei Rhein
zu Zweibrücken Herzog
von Bayern
(26.3.1584-9.8.1635), beigesetzt
in der Zweibrücker
Alexanderskirche, vermählt
mit Louise Juliane
Pfalzgräfin bei Rhein
(16.7.1594-28.4.1640),
der Tochter von Friedrich
IV. Kurfürst von der
Pfalz (5.3.1574-9.9.1610)
und Luise Juliane Gräfin
von Nassau
(31.3.1576-15.3.1644)
- Friedrich
Pfalzgraf bei Rhein zu
Zweibrücken Herzog von
Bayern
(5.4.1616-9.7.1661), beigesetzt
in der Zweibrücker
Alexanderskirche, vermählt
mit Anna Juliane Gräfin
von Nassau
(18.4.1617-29.12.1667),
der Tochter von Wilhelm
Ludwig Graf von
Nassau-Saarbrücken
(18.12.1590-22.8.1640)
und Anna Amalia
Markgräfin von
Baden-Durlach
(9.7.1595-18.11.1651)
- Carola/Charlotte
Friederike Pfalzgräfin
bei Rhein zu Zweibrücken
(2.12.1653-27.10.1712), Epitaph in
der Gruftkapelle
Meisenheim, vermählt
am 14.11.1672 in
Meisenheim mit Wilhelm
Ludwig Erbprinz bei Rhein
zu Zweibrücken
(1648-31.8.1675), dem
Sohn von Friedrich Ludwig
Pfalzgraf bei Rhein zu
Zweibrücken Herzog von
Bayern
(27.10.1619-11.4.1681)
und Juliane Magdalena
Pfalzgräfin bei Rhein zu
Zweibrücken
(23.4.1621-15.10.1672)
- Karl
Ludwig Pfalzgraf bei
Rhein zu Zweibrücken
(18.8.1673-10.11.1674),
starb jung
- Wilhelm
Christian Pfalzgraf bei
Rhein zu Zweibrücken
(5.7.1674-28.11.1674),
starb jung
- Wilhelmine
Sophia Pfalzgräfin bei
Rhein zu Zweibrücken
(27.7.1675-5.11.1675),
starb jung
- Friedrich
Kasimir Pfalzgraf bei
Rhein zu
Zweibrücken-Landsberg
(10.6.1585-30.9.1645), bekam
das Amt Landsberg mit der
Burg Moschellandsberg als
Apanage eines
nachgeborenen Sohnes und
begründete 1604 die neue
Linie Pfalz-Landsberg, die jedoch
nur zwei Generationen
lang blühte, beigesetzt
in der Zweibrücker
Alexanderskirche, vermählt
mit Amalie (Emilia
Secunda Antwerpiana)
Prinzessin von Oranien
(9.12.1581-28.9.1657), beigesetzt
in der Fürstengruft der
Meisenheimer
Schloßkirche, der
Tochter von Wilhelm I.
Fürst von Nassau-Oranien
(1533-1584) und Charlotte
de Bourbon
(1546-5.5.1582)
- Friedrich
Pfalzgraf bei Rhein zu
Zweibrücken-Landsberg
(14.8.1617-15.8.1617), Epitaph in
der Gruftkapelle
Meisenheim, starb als
Säugling
- Johann
Kasimir Pfalzgraf bei
Rhein zu Kleeburg Herzog
von Bayern
(20.4.1589-18.6.1652),
vermählt mit Catharina
Prinzessin von Schweden
(19.11.1584-1638)
- Adolf
Johann I. Pfalzgraf bei
Rhein zu Kleeburg Herzog
von Bayern
(11.10.1629-14.10.1689),
vermählt mit Elsa
Elisabeth Brahe
(29.1.1632-24.2.1689)
- Gustav
Samuel Leopold Pfalzgraf
bei Rhein zu
Zweibrücken-Kleeburg
Herzog von Bayern
(12.4.1670-17.9.1731), in
Kleeburg, Landsberg und
Zweibrücken, 1696
katholisch, 1731-1734
kaiserliche
Sequestration, vermählt
in erster Ehe am
10.7.1707 in Zweibrücken
mit Dorothea Pfalzgräfin
bei Rhein zu Veldenz
(16.1.1658-17.8.1723) und
in zweiter Ehe am
13.5.1723 in Zweibrücken
mit Luise Dorothea
Gräfin von Hoffmann
(30.3.1700-14.4.1745),
kinderlos
Christine
Pfalzgräfin bei Rhein zu Zweibrücken-Neuburg
Das ca. 4 m hohe und 1,90 m
breite, aus Kalkstein gehauene Epitaph, eine Arbeit des
Bildhauers Conrad Wohlgemuth, befindet sich an der Ostwand der
Grabkapelle, auf der linken Seite der Wand. Markant ist die
Bekrönung aus drei Obelisken. Vom Typ her handelt es sich um
eine mehrzonige Pilasterädikula. Den seitlichen Rand bilden
Voluten mit geflügelten Engelsköpfen und Fruchtgehängen. Den
unteren Abschluß bildet ein liegender Putto mit Memento mori.
Das Grabdenkmal, aus der Werkstatt des Meisters Conrad Wolgemuth
aus Simmern kommend, welcher ein Schüler des Bildhauers Johann
von Trarbach war, ist sehr gut erhalten und wurde 1896 ein klein
wenig restauriert. Es gibt mehrere Inschriften am Epitaph,
sämtlich golden auf schwarzen Schiefertafeln ausgeführt:
- ganz oben der Bibelspruch:
"CHRISTVS HAT DEM TODT DIE MACHT GENOMMEN, / VND DAS
LEBE(N) VND EIN VNVERG(A)ENGLICH WESEN / ANS LICHT
GEBRACHT DVRCH DAS EVANGELION / 2 AD, THIMOTHAEVM I
VER(S) X".
- im Hauptfeld die biographischen
Angaben: "DIE DVRCHLEVCHTIGE HOCHGEBORNE / FVRSTIN
VND FREWLIN FRAWLIN / CHRISTINA PFALTZGREVIN BEY RHEI(N)
/ HERTZOGIN IN BAYERN, GRÄVIN ZV / VELDENTZ VND
SPONHEIM, HERTZOG / WOLFFGANGS PFALTZGRAVEN BEY RHEI(N)
& / VND FRAWEN ANNA LANDGR(A)EVI(N) ZV / HESSEN,
TOCHTER, IST IN DIESE WELT / GEBOR(E)N ZV ZWAYBRVCKEN DEN
XXVIIII. / FEBRVARII ANNO M D XLVI VND AVS / DERSELBEN
VON GOTT ZV SICH IN DIE / HIM(M)LISCHE FREWDE ABGEFORDERT
/ DEN XII. MARTII ANNO M DC XVIIII IST / ALHIE ZV
MEISENHEIM ZV IHREN / HOCHLÖBLICHEN VORELTERN
VER=/SAM(M)LET, VND IN DERSELBEN GRABE / CHRISTLICH ZVR
ERDEN BESTATTET / DEN XXIII MARTII ANNO M DC XIX".
- unten ein zweites Bibelzitat:
"GEHE HIN MEIN VOLCK IN EINE KAM(M)ER VND / SCHLEVS
DIE THVR NACH DIR ZV VERBIRGE / DICH EIN KLEIN AVGENBLICK
BIS DER ZORN / FVRVBER GEHE ESAIE XXVI".
- ganz unten ein Bibelvers zum Sterben
und Leben: "CHRISTVS IST MEIN LEBEN, VND STERBEN /
IST MEIN GEWINN ZVN PHILIPPERN AM I. VER(S) XXI".
Übersicht über Genealogie und Abstammung:
- Alexander Pfalzgraf bei Rhein zu
Zweibrücken Herzog von Bayern (26.11.1462-1514),
vermählt mit Margareta von
Hohenlohe-Waldenburg-Neuenstein (30.7.1480-3.9.1522), der
Tochter von Kraft VI. von Hohenlohe-Waldenburg-Neuenstein
und Helene von Württemberg
- Ludwig II. Pfalzgraf bei Rhein
zu Zweibrücken Herzog von Bayern
(14.9.1502-3.12.1532), vermählt mit Elisabeth
von Hessen (10.9.1503-4.1.1563), der Tochter von
Wilhelm I. Landgraf von Hessen
(4.7.1466-8.2.1515) und Anna von
Braunschweig-Wolfenbüttel (-16.5.1520)
- Wolfgang Pfalzgraf bei
Rhein zu Zweibrücken Herzog von Bayern
(26.9.1526-11.6.1569), 1532 zu
Zweibrücken, 30.6.1557 Kauf der
"jungen Pfalz", 1559 zu Neuburg
und Sulzbach, 1566 zu Sponheim, vermählt
mit Anna von Hessen (26.10.1529-1591),
der Tochter von Philipp I. Landgraf von
Hessen (13.11.1504-31.3.1567) und
Christina von Sachsen
(25.12.1505-15.4.1549)
- Christine
Pfalzgräfin bei Rhein zu
Zweibrücken-Neuburg
(29.2.1546-12.3.1619),
unvermählt und kinderlos. Sie
war eigentlich mit Herzog
Friedrich Kasimir von Teschen
verlobt, doch der starb schon
kurz darauf; die Hochzeit wurde
nie vollzogen. Statt dessen nahm
sie ihren Wohnsitz im
Schlößchen in Odernheim und
engagierte sich karitativ. Sie
starb in Odernheim und wurde
danach nach Meisenheim
überführt.
Zum Verständnis der Ahnenprobe, Eltern:
- (1) Wolfgang Pfalzgraf bei Rhein zu
Zweibrücken Herzog von Bayern (26.9.1526-11.6.1569)
- (2) Anna von Hessen (26.10.1529-1591)
Großeltern:
- (1) Ludwig II. Pfalzgraf bei Rhein zu
Zweibrücken Herzog von Bayern (14.9.1502-3.12.1532)
- (3) Elisabeth von Hessen
(10.9.1503-4.1.1563)
- (2) Philipp I. Landgraf von Hessen
(13.11.1504-31.3.1567)
- (4) Christina von Sachsen
(25.12.1505-15.4.1549)
Urgroßeltern:
- (1) Alexander Pfalzgraf bei Rhein zu
Zweibrücken Herzog von Bayern (26.11.1462-1514)
- (5) Margareta von
Hohenlohe-Waldenburg-Neuenstein (30.7.1480-3.9.1522)
- (3) Wilhelm I. Landgraf von Hessen
(4.7.1466-8.2.1515)
- (7) Anna von
Braunschweig-Wolfenbüttel (-16.5.1520)
- (2) Wilhelm II. Landgraf von Hessen
(29.3.1469-11.7.1509)
- (6) Anna von Mecklenburg
(14.9.1485-12.5.1525)
- (4) Georg Herzog von Sachsen
(27.8.1471-15.2.1539)
- (8) Barbara von Polen
(15.7.1478-15.2.1534)
Zentrales Wappen oben: Herzogtum
Pfalz-Zweibrücken, geviert aus Pfalz und
Wittelsbach, Herzschild Veldenz, zwei Helme, Löwe zwischen
Büffelhörnern und Löwe zwischen Flug.
Wappen der Ahnenprobe:
- (1) Schwertseite, ganz oben
("PFALTZ"), Herzogtum
Pfalz-Zweibrücken (wie oben, Komponenten:
Pfalz, Wittelsbach, Veldenz)
- (2) Spindelseite, ganz oben
("HESSEN"), Landgrafschaft Hessen
(Komponenten: Katzenelnbogen, Ziegenhain, Nidda, Diez,
Hessen)
- (3) Schwertseite, zweiter Schild von
oben ("HESSEN"), Landgrafschaft Hessen
(Komponenten: Katzenelnbogen, Ziegenhain, Nidda, Diez,
Hessen)
- (4) Spindelseite, zweiter Schild von
oben ("SACHSEN"), Herzogtum Sachsen
(Rautenkranz)
- (5) Schwertseite, dritter Schild von
oben ("HOHENLOCH"), Grafschaft
Hohenlohe (interessante, nichtexistente
Kombination, gemeint ist wohl der zeitweise
aufrechterhaltene Anspruch auf Ziegenhain und Nidda, im
Detail anders)
- (6) Spindelseite, dritter Schild von
oben ("MECKELNBVRG"), Herzogtum
Mecklenburg (Komponenten: Mecklenburg, Stargard,
Wenden, Rostock, Schwerin)
- (7) Schwertseite, vierter Schild von
oben ("BRAUNSCHWEIG"), Herzogtum
Braunschweig (Komponenten: Braunschweig,
Lüneburg, Everstein, Homburg)
- (8) Spindelseite, vierter Schild von
oben ("POLEN"), Königreich Polen
(in Rot ein silberner Adler)
Carola/Charlotte
Friederike Pfalzgräfin bei Rhein zu Zweibrücken
Das Epitaph befindet sich an der Ostwand der Grabkapelle, auf der
rechten Seite der Wand. Das ist das späteste Grabdenkmal in der
Serie, rund 100 Jahre nach den anderen von einem unbekannten
Künstler angefertigt, doch es fügt sich stilistisch gut in die
vorgegebene Tradition innerhalb dieser Grabkapelle ein. Von der
Heraldik her ist es eines der interessanteren Epitaphien, weil
hier besonders viele komplex zusammengesetzte Wappen zu finden
sind, was auch am späten Herstellungsjahr liegt, denn
zwischenzeitlich sind die Wappen der einschlägigen
Fürstenfamilien komplexer geworden. Sämtliche Inschriften am
Epitaph sind golden auf schwarzen Schiefertafeln ausgeführt:
- in der Gebälkzone: "GENERATIO
VNA ABIT ET ALTERA / ADVENIT ECCLES I VERS 4" - die
eine Generation tritt ab, und die andere kommt.
Vollständig lautet der Kontext in Prediger 1, 3-5: Was
hat der Mensch für Gewinn von aller seiner Mühe, die er
hat unter der Sonne? Ein Geschlecht vergeht, das andere
kommt; die Erde aber bleibt ewiglich. Die Sonne geht auf
und geht unter und läuft an ihren Ort, daß sie wieder
daselbst aufgehe."
- im Zentralfeld befindet sich die
Inschrift mit den biographischen Daten: "MONUMENTUM
HOC / CONSANGUINEAE SUAE CARISSIMAE, / SERENISS. PRINCIPI
CAROLAE FRIDERICAE / FRIDERICI COM PALAT RHENI IN BIPONT
ULTIMI FILIAE / NATAE D(IE) XXII NOVEMBR(IS) AN(NO)
MDCLIII / NUPTUI DATAE D(IE) XIV NOVEMBR(IS) AN(NO) LXXII
PRINCIPI / WILHELMO LUDOVICO COM. PALAT. RHEN. &C. /
FRIDERICI LUDOV(ICI) LANDSBERG. ULTIMI FILIO / MARITO
AN(NO) LXXV VITA DEFUNCTO / DUCATUM BIPONT. PER QUINQUE
ANNO(S) REGIS SUE / REGENTI / TANDEM IN PRAEDIO
DÜRRMOSCHELL D(IE) XXVII OCTO(BRIS) / ANN)O) MDCCXII
EXTINCTAE / CONDITORIOQUE HUIC SERENISSIMOR MAIORUM /
ILLATAE / ERIGI VOLUIT / SERENISS. PRINCEPS GUSTAVUS
SAMUEL LEOPOLDUS / COM. PALAT. RHEN. DUX BAVAR. CLIV. ET
MONT. &C. / REGI SUECIAE CAROLO XII IN DUCATU /
BIPONTINO SUCCEDENS / ANNO MDCCXXI.". Das bedeutet:
Seiner heißgeliebten Blutsverwandten, der
durchlauchtigsten Prinzessin Carola Friderica, Tochter
des Pfalzgrafen Friedrich bei Rhein, des letzten der
Linie zu Zweibrücken, geboren am 22.11.1653, vermählt
am 14.11.1672 mit dem Prinzen Wilhelm Ludwig Pfalzgraf
bei Rhein etc., dem Sohn Friedrich Ludwigs, des letzten
der Landsberger Linie, die nach dem Ableben ihres
Ehemannes im Jahr 1675 fünf Jahre lang im Namen des
schwedischen Königs das Herzogtum Zweibrücken regiert
hatte und die zuletzt am 27.10.1712 auf dem Hofgut
Dürrmoschel verschied und in diese Gruft ihrer
durchlauchtigsten Vorfahren überführt wurde, dieser hat
der durchlauchtigste Fürst Gustav Samuel Leopold
Pfalzgraf bei Rhein, Herzog in Bayern, von Cleve und Berg
&C., des schwedischen Königs Karl XII. Nachfolger im
Herzogtum Zweibrücken, im Jahre 1721 dieses Denkmal
errichten lassen. Was diese Inschrift nicht erwähnt und
eigentlich die größte und verdienstvollste Leistung der
Verstorbenen war, ist die Tatsache, daß sie Meisenheim
vor der Zerstörung gerettet hatte. Das hat ihr
Großcousin bei der Anfertigung der Grabinschrift
unterschlagen.
- in der Sockelzone folgt noch ein
Bibelspruch
Übersicht über Genealogie und Abstammung:
- Wolfgang Pfalzgraf bei Rhein zu
Zweibrücken Herzog von Bayern (26.9.1526-11.6.1569),
vermählt mit Anna von Hessen (26.10.1529-1591)
- Johann I. Pfalzgraf bei Rhein
zu Zweibrücken Herzog von Bayern
(1550-12.8.1604), vermählt mit Magdalena
Herzogin von Cleve (1553-30.8.1633), der Tochter
von Wilhelm V. Herzog von Cleve, Jülich und Berg
Graf von der Mark und von Ravensberg
(28.7.1516-1592) und Maria von Österreich
(15.5.1531-11.12.1581)
- Johann II. Pfalzgraf
bei Rhein zu Zweibrücken Herzog von
Bayern (26.3.1584-9.8.1635), vermählt
mit Louise Juliane Pfalzgräfin bei Rhein
(16.7.1594-28.4.1640), der Tochter von
Friedrich IV. Kurfürst von der Pfalz
(5.3.1574-9.9.1610) und Luise Juliane
Gräfin von Nassau (31.3.1576-15.3.1644)
- Friedrich
Pfalzgraf bei Rhein zu
Zweibrücken Herzog von Bayern
(5.4.1616-9.7.1661), vermählt
mit Anna Juliane Gräfin von
Nassau (18.4.1617-29.12.1667),
der Tochter von Wilhelm Ludwig
Graf von Nassau-Saarbrücken
(18.12.1590-22.8.1640) und Anna
Amalia Markgräfin von
Baden-Durlach
(9.7.1595-18.11.1651)
- Carola/Charlotte
Friederike Pfalzgräfin
bei Rhein zu Zweibrücken
(2.12.1653-27.10.1712),
vermählt am 14.11.1672
in Meisenheim mit Wilhelm
Ludwig Erbprinz bei Rhein
zu Zweibrücken
(1648-31.8.1675), dem
Sohn von Friedrich Ludwig
Pfalzgraf bei Rhein zu
Zweibrücken Herzog von
Bayern
(27.10.1619-11.4.1681)
und Juliane Magdalena
Pfalzgräfin bei Rhein zu
Zweibrücken
(23.4.1621-15.10.1672)
- Karl
Ludwig Pfalzgraf bei
Rhein zu Zweibrücken
(18.8.1673-10.11.1674)
- Wilhelm
Christian Pfalzgraf bei
Rhein zu Zweibrücken
(5.7.1674-28.11.1674)
- Wilhelmine
Sophia Pfalzgräfin bei
Rhein zu Zweibrücken
(27.7.1675-5.11.1675)
Genealogie des Stifters des Epitaphs, einem
Großcousin der Verstorbenen:
- Johann I. Pfalzgraf bei Rhein zu
Zweibrücken Herzog von Bayern (1550-12.8.1604),
vermählt mit Magdalena Herzogin von Cleve
(1553-30.8.1633)
- Johann Kasimir Pfalzgraf bei
Rhein zu Kleeburg Herzog von Bayern
(20.4.1589-18.6.1652), vermählt mit Catharina
Prinzessin von Schweden (19.11.1584-1638)
- Adolf Johann I.
Pfalzgraf bei Rhein zu Kleeburg Herzog
von Bayern (11.10.1629-14.10.1689),
vermählt mit Elsa Elisabeth Brahe
(29.1.1632-24.2.1689)
- Gustav Samuel
Leopold Pfalzgraf bei Rhein zu
Zweibrücken-Kleeburg Herzog von
Bayern (12.4.1670-17.9.1731), in
Kleeburg, Landsberg und
Zweibrücken, 1696 katholisch,
1731-1734 kaiserliche
Sequestration, vermählt in
erster Ehe am 10.7.1707 in
Zweibrücken mit Dorothea
Pfalzgräfin bei Rhein zu Veldenz
(16.1.1658-17.8.1723) und in
zweiter Ehe am 13.5.1723 in
Zweibrücken mit Luise Dorothea
Gräfin von Hoffmann
(30.3.1700-14.4.1745), kinderlos
Zum Verständnis der Ahnenprobe, Eltern:
- (1) Friedrich Pfalzgraf bei Rhein zu
Zweibrücken Herzog von Bayern (5.4.1616-9.7.1661)
- (2) Anna Juliane Gräfin von Nassau
(18.4.1617-29.12.1667
Großeltern:
- (1) Johann II. Pfalzgraf bei Rhein zu
Zweibrücken Herzog von Bayern (26.3.1584-9.8.1635)
- (3) Louise Juliane Pfalzgräfin bei
Rhein (16.7.1594-28.4.1640)
- (2) Wilhelm Ludwig Graf von
Nassau-Saarbrücken (18.12.1590-22.8.1640)
- (4) Anna Amalia Markgräfin von
Baden-Durlach (9.7.1595-18.11.1651)
Urgroßeltern:
- (1) Johann I. Pfalzgraf bei Rhein zu
Zweibrücken Herzog von Bayern (1550-12.8.1604)
- (5) Magdalena Herzogin von Cleve
(1553-30.8.1633)
- (3) Friedrich IV. Kurfürst von der
Pfalz (5.3.1574-9.9.1610)
- (7) Luise Juliane Gräfin von Nassau
(31.3.1576-15.3.1644)
- (2) Ludwig II. Graf von
Nassau-Weilburg (9.8.1565-8.11.1627)
- (6) Anna Maria Landgräfin von
Hessen-Kassel (27.1.1567-21.11.1626)
- (4) Georg Friedrich Markgraf von
Baden-Durlach (1573-24.9.1638)
- (8) Juliane Ursula Wild- und
Rheingräfin von Dhaun-Neufviller (28.9.1572-30.4.1614)

Hauptwappen oben in der Mitte als Aufsatz: Herzogtum
Pfalz-Zweibrücken, gespalten aus Pfalz-Wittelsbach mit
Veldenz als Herzschild rechts und
Jülich-Cleve-Berg-Mark-Ravensberg-Moers links, mit allen fünf
Kleinoden, wie oben bei der Gruftplatte beschrieben.
Wappen der Ahnenprobe:
- (1) Schwertseite, ganz oben
("PFALTZ ZWEY / BRUCKEN"), Herzogtum
Pfalz-Zweibrücken (4 + 6 Felder + Herzschild
Veldenz)
- (2) Spindelseite, ganz oben
("NASSAU / SAARBRUCK"), Grafschaft
Nassau-Weilburg-Saarbrücken (7 Felder +
Herzschild)
- (3) Schwertseite, zweiter Schild von
oben ("CHVRPFALTZ"), Pfalzgrafschaft
bei Rhein (4 Felder + Herzschild)
- (4) Spindelseite, zweiter Schild von
oben ("BADEN / DURLACH"), Markgrafschaft
Baden-Durlach (10 Felder)
- (5) Schwertseite, dritter Schild von
oben ("IVLICH"), Herzogtum
Jülich-Cleve-Berg (6 Felder, Komponenten:
Jülich, Cleve, Berg, Mark, Ravensberg, Moers)
- (6) Spindelseite, dritter Schild von
oben ("HESSEN / CASSELL"),
Landgrafschaft Hessen-Kassel (4 Felder +
Herzschild, Komponenten: Katzenelnbogen, Ziegenhain,
Nidda, Diez, Hessen)
- (7) Schwertseite, vierter Schild von
oben ("VRANIEN"), Fürstentum
Nassau-Oranien (4 Felder + Mittelschild 4 Felder
+ Herzschild, Komponenten: Hauptschild Nassau, Katzenelnbogen, Vianden, Diez; Mittelschild
Chalon, Oranien; Herzschild Genf)
- (8) Spindelseite, vierter Schild von
oben ("...."), Wild- und Rheingrafen
von Dhaun (4 Felder + Herzschild mit 3 Inhalten)
Friedrich
Pfalzgraf bei Rhein zu Zweibrücken-Landsberg
Dieses ca. 3 m hohe und 1,90 m breite Epitaph aus gelbgeädertem
Kalkstein ist an der Südwand der Grabkapelle links an der Wand
angebracht. Vom Typ her ist es eine schlichte Pilasterädikula,
die durch üppigen Wappenschmuck beeindruckt. Die beiden
bekrönenden Vollwappen werden von zwei sitzenden Putten als
Schildhaltern begleitet. Der gestalterische Aufwand überrascht,
denn hier wird an einen Säugling erinnert, der nur einen Tag
lang lebte. Der unglaubliche Aufwand ist wohl ein Maß für die
Enttäuschung und Trauer der frischvermählten Eltern, die sich
auf ihren Erstgeborenen gefreut hatten. In der Sockelzone sind
Totenkopf und Todeswerkzeuge als Memento mori angebracht.
Aufwendige, in Voluten eingespannte Karyatiden bilden die
Seitenflanken. Das Epitaph ist vermutlich eine Arbeit von Meister
Conrad Wolgemuth aus Simmern, welcher ein Schüler des Bildhauers
Johann von Trarbach war. Das Grabdenkmal ist sehr gut erhalten
und wurde 1896 ein klein wenig restauriert. Die Inschrift am
Epitaph ist golden auf schwarzer Schiefertafel ausgeführt:
- eine große lateinische Inschrift in
der Hauptzone mit sämtlichen biographischen Daten:
"FRIDERICVS PALATINVS RHENI, & FRIDERICI /
CASIMIRI, PALAT(INI) RHENI, BAV(ARIAE) IVL(IAE) CLIV(IAE)
MONT(IS) / DVCIS, COMITIS VELD(ENCIAE) SPONH(EIMII) &
ET AMALIAE, / INCLYTAE PRINCIP(ISSAE) AVRAICAE,
COMIT(ISSAE) NASSOV(IAE) & / FILIVS: NATVS EST IN
ARCE LANDSPERG / ANN(O) CHR(IST)I MDCXVII DIE IV
AVG(VSTI) POST / MEDIVM NOCTIS, PAVLO ANTE HORA(M) PRIMAM
/ POSTERO VERO DIE IN NO(M)I(N)E S(ANCTAE) TRINITATIS, /
SVB HORA NOCTIS XII. BAPTIZATVS, CONTI=/NVO EIVSDEM DIEI
HORA PRIMA POMERID(IANA) / EX HAC VITA DECESSIT
MEISENHEIMIA(M) / DEINDE VIII, DIE AVG(VSTI) TRANSLATVS,
ET IN / HOC MONVMENTO PROAVORVM SVORVM, / LAVDATISSIMAE
SEMPER MEMORIAE, HONORIFICE / SEPVLTVS EST, EXPECTANS
APPARITIONEM / GLORIAE MAGNI DEI ET SERVATORIS NOSTRI /
IESV CHR(IST)I: CVIVS VOCE EXCITATVS MAGNA / CVM POMPA ET
MAIESTATE DEDVCETVR IN / SPLENDIDISSI(MAM) ET COELESTEM
HIEROSOLYMAM, / ET CVM SALVATORE SVO IESV CHR(IST)O /
REGNABIT AC VIVET IN AETERNVM / VENI VENI ETIAM VENI
DOMINE IESV APOC(ALYPSIS) XXII". Das bedeutet:
Friedrich Pfalzgraf bei Rhein etc., Sohn von Friedrich
Casimir Pfalzgraf bei Rhein, Herzog in Bayern, zu
Jülich, Cleve und Berg, Graf zu Veldenz und Sponheim
etc. und der erlauchten Fürstin Amalie von Oranien,
Gräfin von Nassau etc., geboren auf der Burg Landsberg
im Jahre Christi 1617 am 4. Tag des Augusts nach
Mitternacht kurz vor der 1. Stunde, wurde er am folgenden
Tag während der 12. Stunde der Nacht im Namen der
heiligen Dreifaltigkeit getauft und schied alsbald in der
1. Stunde des Nachmittags desselben Tags aus dem Leben.
Daraufhin wurde er am 8. Tag des Augusts nach Meisenheim
überführt und in dieser Gruft seiner Vorfahren in
fortwährend hochlöblichem Angedenken mit allen Ehren
bestattet, wo er nun auf die Erscheinung der Herrlichkeit
des großen Gottes und unseres Erlösers Jesu Christi
wartet. Durch dessen Stimme erweckt, wird er mit großer
Pracht und Würde in das äußerst prächtige und
himmlische Jerusalem geführt werden und mit seinem
Erlöser Jesus Christus regieren und leben in Ewigkeit.
Komm, komm, ja komm, Herr Jesus!
Übersicht über Genealogie und Abstammung:
- Ludwig II. Pfalzgraf bei Rhein zu
Zweibrücken Herzog von Bayern (14.9.1502-3.12.1532),
vermählt mit Elisabeth von Hessen (10.9.1503-4.1.1563),
der Tochter von Wilhelm I. Landgraf von Hessen
(4.7.1466-8.2.1515) und Anna von
Braunschweig-Wolfenbüttel (-16.5.1520)
- Wolfgang Pfalzgraf bei Rhein
zu Zweibrücken Herzog von Bayern
(26.9.1526-11.6.1569), 1532 zu Zweibrücken,
30.6.1557 Kauf der "jungen Pfalz", 1559
zu Neuburg und Sulzbach, 1566 zu Sponheim,
vermählt mit Anna von Hessen (26.10.1529-1591),
der Tochter von Philipp I. Landgraf von Hessen
(13.11.1504-31.3.1567) und Christina von Sachsen
(25.12.1505-15.4.1549)
- Johann I. Pfalzgraf
bei Rhein zu Zweibrücken Herzog von
Bayern (1550-12.8.1604), vermählt mit
Magdalena Herzogin von Cleve
(1553-30.8.1633), der Tochter von Wilhelm
V. Herzog von Cleve, Jülich und Berg
Graf von der Mark und von Ravensberg
(28.7.1516-1592) und Maria von
Österreich (15.5.1531-11.12.1581)
- Friedrich
Kasimir Pfalzgraf bei Rhein zu
Zweibrücken-Landsberg
(10.6.1585-30.9.1645), bekam das
Amt Landsberg mit der Burg
Moschellandsberg als Apanage
eines nachgeborenen Sohnes und
begründete 1604 die neue Linie
Pfalz-Landsberg, die jedoch nur
zwei Generationen lang blühte,
vermählt mit Amalie (Emilia
Secunda Antwerpiana) Prinzessin
von Oranien
(9.12.1581-28.9.1657), der
Tochter von Wilhelm I. Fürst von
Nassau-Oranien (1533-1584) und
Charlotte de Bourbon
(1546-5.5.1582)
- Friedrich
Pfalzgraf bei Rhein zu
Zweibrücken-Landsberg
(14.8.1617-15.8.1617)
Zum Verständnis der Ahnenprobe, Eltern:
- (1) Friedrich Kasimir Pfalzgraf bei
Rhein zu Zweibrücken-Landsberg (10.6.1585-30.9.1645)
- (2) Amalie Prinzessin von Oranien
(9.12.1581-28.9.1657)
Großeltern:
- (1) Johann I. Pfalzgraf bei Rhein zu
Zweibrücken Herzog von Bayern (1550-12.8.1604)
- (3) Magdalena Herzogin von Cleve
(1553-30.8.1633)
- (2) Wilhelm I. Fürst von
Nassau-Oranien (1533-1584)
- (4) Charlotte de Bourbon
(1546-5.5.1582)
Urgroßeltern:
- (1) Wolfgang Pfalzgraf bei Rhein zu
Zweibrücken Herzog von Bayern (26.9.1526-11.6.1569)
- (5) Anna von Hessen (26.10.1529-1591)
- (3) Wilhelm V. Herzog von Cleve,
Jülich und Berg Graf von der Mark und von Ravensberg
(28.7.1516-1592)
- (7) Maria von Österreich
(15.5.1531-11.12.1581)
- (2) Wilhelm I. Graf von
Nassau-Dillenburg (10.4.1487-6.10.1559)
- (6) Juliana zu Stolberg-Wernigerode
(15.2.1506-16.6.1580)
- (4) Louis II. de Bourbon Duc de
Montpensier Souverain de Dombes Prince de Roche-sur-Yon
Dauphin d'Auvergne Comte de Chatres et de Mortain
(10.6.1513-23.9.1582)
- (8) Jacqueline de Longwy Comtesse de
Bar-sur-Seine (-28.8.1561)

Das Grabdenkmal trägt zwei elterliche
Hauptwappen oben, rechts Herzogtum Pfalz-Zweibrücken
gespalten mit Herzschild, rechts Pfalz-Wittelsbach, links
Jülich-Cleve-Berg-Marck-Ravensberg-Moers, Herzschild Veldenz,
mit fünf Kleinoden, links Fürstentum Nassau-Oranien,
geviert und mit drei Kleinoden. Dabei ist besonders interessant,
daß das eigentliche Wappen für Nassau-Oranien jeweils in den
Feldern 1 und 4 zu finden ist, geviert, Feld 1: Grafschaft
Nassau, in blauem und mit
goldenen aufrechten Schindeln bestreuten Feld ein goldener Löwe,
rot gezungt, ungekrönt und rot bewehrt, Feld 2: Grafschaft Katzenelnbogen, in Gold ein roter,
hersehender (leopardisierter) Löwe, blau bewehrt und blau
gekrönt, Feld 3: Grafschaft Vianden,
in Rot ein silberner Balken, Feld 4: Grafschaft Diez, in Rot zwei goldene, blau
bewehrte Leoparden (hersehende, schreitende Löwen) übereinander, Mittelschild geviert, Feld 1 und 4: Chalon, in Rot
ein goldener Schrägrechtsbalken, Feld 2 und 3: Fürstentum
Oranien, in Gold ein blaues Jagdhorn mit roten Beschlägen und
ebensolchen Bändern, Herzschild: Grafschaft Genf, in drei Reihen
von Gold und Blau geschacht. Die beiden anderen Viertel des
Wappens, Feld 2 und 3, beziehen sich auf die dritte Ehefrau des
Wilhelm von Oranien, Charlotte de Bourbon-Montpensier,
das ist eine Brisur des französischen Lilienwappens
(Bourbonen-Wappens), in Blau drei (2:1) goldene Lilien, im
Zentrum ein schrägrechter roter Einbruch. Ihr Vater führte das
Wappen noch mit einer kleinen silbernen Mondsichel auf dem
Einbruch, französischer Blason: D'azur aux trois fleurs de lys
d'or et au baton de gueules chargé d'une lune d'argent au
franc-quartier. Hier werden als das großväterliche und das
großmütterliche Wappen für die Mutter des Probanden
miteinander kombiniert. Es sei hervorgehoben, daß Wilhelm von
Oranien dieses Wappen in dieser Form nicht geführt hat. Er wäre
auch nicht dazu berechtigt gewesen, denn Charlottes Bruder
François (1542-1592) erbte den Titel und wurde der nächste Duc
de Monpensier. Das Wappen mit dem Einbruch begegnet uns noch
einmal alleine als Teil der Ahnenprobe. Es ist in der Kirche
nicht das einzige Beispiel, wo bei "ausländischen"
Ehefrauen das väterliche Wappen um das der Mutter ergänzt wird,
etwas Ähnliches gab es bei Croy und Lothringen am Gewölbe der
Grabkapelle und an den Gewölberippenkonsolen im Chor zu
beobachten. Insofern ist dieses Wappen eigentlich das spannendste
in der ganzen Grabkapelle, während alle anderen Wappen sich
entweder wiederholen oder allgemein vertraut sind.
Wappen der Ahnenprobe:
- (1) Schwertseite, ganz oben
("PFALTZ"), Herzogtum
Pfalz-Zweibrücken (Komponenten: Pfalz,
Wittelsbach, Veldenz)
- (2) Spindelseite, ganz oben
("VRANIEN / NASSAW"), Fürstentum
Nassau-Oranien (Komponenten: Hauptschild Nassau,
Katzenelnbogen,
Vianden, Diez; Mittelschild Chalon, Oranien; Herzschild
Genf)
- (3) Schwertseite, zweiter Schild von
oben ("GV¨LICH"), Herzogtum
Jülich-Cleve-Berg (Komponenten: Jülich, Cleve,
Berg, Marck, Ravensberg, Moers)
- (4) Spindelseite, zweiter Schild von
oben ("BOVRBAN"), Bourbon-Montpensier (Brisur
des Bourbonen-Wappens, s. o.)
- (5) Schwertseite, dritter Schild von
oben ("HESSEN"), Landgrafschaft Hessen
(Komponenten: Katzenelnbogen, Ziegenhain, Nidda, Diez,
Hessen)
- (6) Spindelseite, dritter Schild von
oben ("STOLBERG"), Grafschaft
Stolberg-Wernigerode (Komponenten: geviert aus
Stolberg und Wernigerode)
- (7) Schwertseite, vierter Schild von
oben ("ÖSTER=/REICH"), Erzherzogtum
Österreich (Komponenten: geviert aus Altungarn
und Böhmen, Herzschild Österreich)
- (8) Spindelseite, vierter Schild von
oben ("LOGNY"), de Longwy (in
Blau ein goldener Schrägbalken, gemeint ist
Longwy-sur-le-Doubs, nicht das lothringische Longwy)
Anna
Pfalzgräfin bei Rhein zu Zweibrücken-Neuburg
Dieses aus Tuffstein gefertigte Epitaph, ca. 4,40 m hoch und 1,75
m breit, ist rechterhand an der Nordwand der Grabkapelle
angebracht. Im Aufsatz ist zwischen den beiden elterlichen Wappen
in einem Halbkreis die Taufe Christi dargestellt. Es handelt sich
um eine Arbeit des Bildhauers Johann von Trarbach, der auch das
große Epitaph ihrer Eltern links daneben gestaltet hatte. Das
Epitaph wurde Ende des 19. Jh. und noch einmal 1953 ff.
restauriert. Es gibt mehrere Inschriften am Epitaph, sämtlich
auf schwarzen Schiefertafeln ausgeführt:
- ganz oben im Aufsatz passend unter der
Figur des auferstandenen Christus: "Ich bin die
(a)vfferstehung vnnd / das leben, wer an mich glaubt, /
der würt leben ob er gleich stürbe / IOANNIS XI
CAPIT(EL)".
- oben im Gebälk ein weiterer
Bibelspruch: "Meine schaf(e) hören meine stim(me),
vnd Ich kenne sie, vnd sie volgen mir / vnd Ich geb
I(h)nen das ewig(e) leben, vnd sie werden nimmermehr /
vmkommen, vnd niemandt würdt sie aus meiner handt
reissen, / der Vatter der sie mir (ge)geben hat, ist
grösser dan(n) alles, vnd niemandt / würdt sie aus
meines Vatters handt reissen IOAN(NIS) 10
CAPIT(EL)".
- in der Hauptzone die Inschrift mit den
biographischen Angaben: "Die Durchleuchtig
Hochgeborn Fürstin vnd Freülin Freülin / Anna,
Pfaltzgreuin bei Rhein, Hertzogin in Bai(e)rn, Greuin /
zu Veldentz vnd Spahnheim, ist in diese Weldt gebor(e)nn
/ zu Amberg, den 2 Junii ANNO 1554 hat mit Gottes /
gnediger hilff vnd gnaden, in wa(h)rem glauben auch
tugent/licher zucht vnd gehorsam gelebt, biss (a)vff den
13 NOVE(M)B(RIS) / ANNO 1576 vnd ist Ihr gantzes alter
gewessen 22 / Ihar(e) 5 Monat(e) 24 tage, an welchem tag
sie Ihr leben, in / Christlichem glauben vnd bekantnus,
mit rheu(e) I(h)rer / sünden, vnd gewisser hoffnung
vergebung derselben, vff=/erstehung des fleisch(es), vnd
eines ewigen lebens, durch den / verdienst vnser(e)s
seligmachers Ihesu Christi, selig hat be/schlossen, vnd
sich willig im willen gottes, mit gedult / vnd anruffung
zu Gott, ergeben. Ist alhie zu Meisen=/heim, in Ihrer
hochloblichen vorältern grab, Christlich / zur erden
bestatt, den 18 NOVEMBRIS ANNO / 1576 welcher der
Alm(a)echtig(e) Gott, am / Jüngsten tag, mit allen so an
I(h)n glau=/benn, ein(e) selig(e) frö(h)lich(e)
(a)vfferstehung / wöll verleihen, zum Ewigen / leben,
AMEN".
- in der Sockelzone noch aus der
Offenbarung des Johannes 14,13: "O Jhesus dir leb(e)
Ich, dir sterb(e) Ich, Dein bin Ich / Todt vnd lebendig,
/ Selig sindt die Todten, die in dem her(r)n sterben, von
/ nuh an & in der Offenbar(ung) Johan(nis) am
14".
Übersicht über Genealogie und Abstammung:
- Alexander Pfalzgraf bei Rhein zu
Zweibrücken Herzog von Bayern (26.11.1462-1514),
vermählt mit Margareta von
Hohenlohe-Waldenburg-Neuenstein (30.7.1480-3.9.1522), der
Tochter von Kraft VI. von Hohenlohe-Waldenburg-Neuenstein
und Helene von Württemberg
- Ludwig II. Pfalzgraf bei Rhein
zu Zweibrücken Herzog von Bayern
(14.9.1502-3.12.1532), vermählt mit Elisabeth
von Hessen (10.9.1503-4.1.1563), der Tochter von
Wilhelm I. Landgraf von Hessen
(4.7.1466-8.2.1515) und Anna von
Braunschweig-Wolfenbüttel (-16.5.1520)
- Wolfgang Pfalzgraf bei
Rhein zu Zweibrücken Herzog von Bayern
(26.9.1526-11.6.1569), 1532 zu
Zweibrücken, 30.6.1557 Kauf der
"jungen Pfalz", 1559 zu Neuburg
und Sulzbach, 1566 zu Sponheim, vermählt
mit Anna von Hessen (26.10.1529-1591),
der Tochter von Philipp I. Landgraf von
Hessen (13.11.1504-31.3.1567) und
Christina von Sachsen
(25.12.1505-15.4.1549)
- Anna
Pfalzgräfin bei Rhein zu
Zweibrücken-Neuburg
(2.6.1554-13.11.1576),
unvermählt und kinderlos
Zum Verständnis der Ahnenprobe, Eltern:
- (1) Wolfgang Pfalzgraf bei Rhein zu
Zweibrücken Herzog von Bayern (26.9.1526-11.6.1569)
- (2) Anna von Hessen (26.10.1529-1591)
Großeltern:
- (1) Ludwig II. Pfalzgraf bei Rhein zu
Zweibrücken Herzog von Bayern (14.9.1502-3.12.1532)
- (3) Elisabeth von Hessen
(10.9.1503-4.1.1563)
- (2) Philipp I. Landgraf von Hessen
(13.11.1504-31.3.1567)
- (4) Christina von Sachsen
(25.12.1505-15.4.1549)
Urgroßeltern:
- (1) Alexander Pfalzgraf bei Rhein zu
Zweibrücken Herzog von Bayern (26.11.1462-1514)
- (5) Margareta von
Hohenlohe-Waldenburg-Neuenstein (30.7.1480-3.9.1522)
- (3) Wilhelm I. Landgraf von Hessen
(4.7.1466-8.2.1515)
- (7) Anna von
Braunschweig-Wolfenbüttel (-16.5.1520)
- (2) Wilhelm II. Landgraf von Hessen
(29.3.1469-11.7.1509)
- (6) Anna von Mecklenburg
(14.9.1485-12.5.1525)
- (4) Georg Herzog von Sachsen
(27.8.1471-15.2.1539)
- (8) Barbara von Polen
(15.7.1478-15.2.1534)
Zwei Hauptwappen oben für die Eltern:
heraldisch rechts Herzogtum Pfalz-Zweibrücken,
geviert aus Pfalz und Wittelsbach, Herzschild Veldenz, ein Helm,
Löwe zwischen Büffelhörnern, heraldisch links: Landgrafschaft
Hessen, mit nur dem Stammhelm.
Wappen der Ahnenprobe:
- (1) Schwertseite, ganz oben
("Pfaltz"), Herzogtum
Pfalz-Zweibrücken (wie oben, Komponenten:
Pfalz, Wittelsbach, Veldenz)
- (2) Spindelseite, ganz oben
("Hessen"), Landgrafschaft Hessen
(Komponenten: Katzenelnbogen, Ziegenhain, Nidda, Diez,
Hessen)
- (3) Schwertseite, zweiter Schild von
oben ("Hessen"), Landgrafschaft Hessen
(Komponenten: Katzenelnbogen, Ziegenhain, Nidda, Diez,
Hessen)
- (4) Spindelseite, zweiter Schild von
oben ("Sachssen"), Herzogtum Sachsen
(Rautenkranz)
- (5) Schwertseite, dritter Schild von
oben ("Hohenlohe"), Grafschaft
Hohenlohe (interessante, nichtexistente
Kombination, gemeint ist wohl der zeitweise
aufrechterhaltene Anspruch auf Ziegenhain und Nidda, im
Detail anders)
- (6) Spindelseite, dritter Schild von
oben ("Meckelnburg"), Herzogtum
Mecklenburg (Komponenten: Mecklenburg, Stargard,
Wenden, Rostock, Schwerin)
- (7) Schwertseite, vierter Schild von
oben ("Brau(n)schweig"), Herzogtum
Braunschweig (Komponenten: Braunschweig,
Lüneburg, Everstein, Homburg)
- (8) Spindelseite, vierter Schild von
oben ("Polnn"), Königreich Polen
(in Rot ein silberner Adler)
Wolfgang
Pfalzgraf bei Rhein zu Zweibrücken Herzog von Bayern und Anna
von Hessen
Dieses monumentale und reich verzierte Epitaph mißt 6,70 m in
der Höhe und 3,00 m in der Breite. Es ist an der Nordwand der
Grabkapelle gleich links hinter der Gittertür angebracht. Die
monumentale Pfeilerädikula aus Tuffstein steht auf einem
Unterbau aus Sandstein. Es handelt sich um ein Werk des Simmerner
Bildhauers Johann von Trarbach, der einer der besten Bildhauer
seiner Zeit war und an den linksrheinischen Fürstenhöfen der
Renaissancezeit gerne für solche Aufträge engagiert wurde. Das
Epitaph, das 1795 von den französischen Revolutionstruppen in
Meisenheim durch Beschuß schwerst beschädigt wurde, wurde Ende
des 19. Jh. in großen Teilen (die Figur der Spes, die Köpfe,
die Hände und die Oberkörper beider Verstorbenen, sämtliche
Wappen auf den seitlichen Pilastern, fast die komplette
Ornamentik auf den Flächen) ergänzt und noch einmal 1953
restauriert. Es dürfte das am stärksten (und teilweise
kunstlos) ergänzte und am wenigsten originale Epitaph der ganzen
Sammlung sein. Was jedoch noch original ist, ist exquisite
Steinmetzkunst. Es gibt mehrere Inschriften am Epitaph, von oben
nach unten gelistet, sämtlich auf Schiefertafeln ausgeführt:
- auf dem Rand eines Medaillons mit der
Darstellung der Auferstehung und Himmelfahrt Christi,
zusammen mit dem Gekreuzigten die Trinität bildend:
"ICH BIN DIE AVFFERSTEHV(N)G VND DAS LEBE(N), WER AN
MICH GLAVBT DER WIRDT LEBE(N), OB ER GLEICH STVRBE".
- halbrund über einem Relief mit
segnendem Gottvater, Engeln und der Taube des Heiligen
Geistes: "Di(e)ss ist mein lieber Sohn, an welchem
Ich wo(h)lgefallen habe den sol(l)t ihr hören. Math. 3.
17".
- Datierung des Epitaphs auf dem
verkröpften Gebälk: "AN(N)O / 1575".
- im Hintergrund über dem in eine
Prunkrüstung gekleideten Herzog Wolfgang, in gotischer
Fraktur: "Ich weiss das(s) mein Erlöser lebet, vnd
/ er würdt mich hernach auss der Erden / auffwecken. Vnd
werde darnach mit / dieser meiner haut vmgeben werden /
vnd werde in meinem fleisch Gott / sehen. IOB. CAP:
XIX".
- im Hintergrund über der in ein langes
Gewand und Haube gekleideten Herzogin Anna: "Also
hatt Gott die Weltt geliebet, / das(s) er seinen
eingebor(e)nen Shon / gabe, auff das alle die an I(h)n
glau=/ben nicht verloren werden, son=/der(n) das Ewig(e)
leben haben. / IOAN: CAP: III".
- am Sockel optisch links unter Herzog
Wolfgang die Inschrift in goldenen Antiqua-Buchstaben mit
den biographischen Daten: "WOLFGANGVS PALA(TINVS)
RHENI, LVDO(VICI) PALA(TINI) ET D(OMINAE) ELIZABETHAE
RVPERTI IMP(ERATORIS) RO(MANORUM) ATNEP(OS) PRINCEPS
IVSTICIA FORTITVD(INE) ET LIBERALITA(TE) INCLYT(VS) /
PROVINCIAS SVAS OPT(IMIS) LEGIB(VS) ET HONESTISS(IMA)
DISCIPLINA AN(NOS) XXVI REXIT PVRA(M) / EVANGE(LII)
DOCTRINA(M) TEMPORE PERICVLOSISS(IMO) CONFESSVS ET
TVTATVS EST / ECCLE(SIAS) SVAS IDOLATRIA PAPISTICA ET
ALIIS SECTIS ABOLITIS, RECTE DO=/CERI CVRAVIT SCHOLAS
LAVING(AE) ET HORNBACH(I) CONSTITVIT MAX(IMILIANO) II
IMP(ERATORI) / RO(MANORVM) CONTRA SOLIMANV(M) TVRCAM, CVM
F(ILIO) D(OMINO) PHILIP(PO) LVDO(VICO) SVIS IN HV(N)GARIA
/ STIPENDIIS MILITAVIT VALIDVM GERMA(NVM) EXERCITVM IN
GALLIA(M) VLTRA / LIGERIM DVXIT, ET RELIGIO(NIS) NOMINE
AFFLICTIS OPEM, ET TVRBATO / REGNO PACEM ATTVLIT QVA IN
EXPEDITIO(NE) APVD LEMOVICES IN PAGO / NESSIN FEBRI
MORTALEM HANC VITAM PIE FINIVIT, III. ID(VS) IVNII,
AN(NO) M / D LXIX CVM VIXISSET AN(NOS) XLIII MEN(SES)
VIII D(IES) XXII CVIVS CORPVS MOES=/TISS(IMAE) CONIVGIS
D(OMINAE) ANNAE, ET F(ILIORVM) D(OMINORVM) PHILIP(PI)
LVDO(VICI) ET IOHAN(NIS) PIETATE, EX GALL(IA) TERRA
MARIQ(VE) DEPORTATVM ET IN HOC D(OMINI) LVDO(VICI) PROAVI
SE=/PVLCH(RVM) ILLATVM EST, IX CAL(ENDAS) OCTOBRIS AN(NO)
M D LXXI". Das bedeutet: Wolfgang Pfalzgraf bei
Rhein, Sohn des Pfalzgrafen Ludwig und Frau Elisabeth
Landgräfin von Hessen, Ururgroßenkel des römischen
Kaisers Ruprecht, ein Fürst, der berühmt ist durch
Gerechtigkeit, Tapferkeit und edle Gesinnung, regierte
seine Ländereien 26 Jahre lang nach den besten Gesetzen
und ehrenwertesten Grundsätzen. Er hat sich auch in
gefährlichster Zeit zur reinen Lehre des Evangeliums (d.
h. Protestantismus) bekannt und sie beschützt, nachdem
der papistische Götzendienst und die anderen Sekten
abgeschafft worden waren, er hat dafür gesorgt, daß
seine Kirchengemeinden unterrichtet werden, er hat zu
Lauingen und Hornbach Schulen gegründet, und hat unter
dem römischen Kaiser Maximilian II. mit seinem Sohn,
Herrn Philipp Ludwig, in Ungarn mit seinen eigenen
Soldaten gegen den Türken Suleiman gekämpft. Er führte
ein gewaltiges deutsches Heer nach Frankreich bis über
die Loire und brachte den um des Glaubens willen
Bedrängten Hilfe und dem gepeinigten Reich den Frieden.
Bei diesem Feldzug beendete er im Dorf Nexon bei Limoges
durch ein Fieber fromm dieses vergängliche Leben an den
3. Iden des Juni (= 11. Juni, 3 Tage vor den Iden des
Juni) im Jahr 1569, nachdem er 43 Jahre, 8 Monate und 22
Tage gelebt hatte. Sein Leichnam wurde durch die
Frömmigkeit der höchstbetrübten Gemahlin, Frau Anna,
und ihrer Söhne Philipp Ludwig und Johann aus Frankreich
über Land und Meer überführt und in der Gruft seines
Urgroßvaters Ludwig bestattet, an den 9. Kalenden des
Oktobers (= 23. September, 9 Tage vor dem Monatsersten),
im Jahr 1571.
- am Sockel optisch rechts unter
Herzogin Anna die Inschrift mit den biographischen Daten:
"ANNA PALA(TINA) RHENI · PHILIP(PI) SEN(IORIS)
LANDGRA(VII) HASS(IAE) ET CHRISTINAE / DVCIS SAXO(NIAE)
F(ILIA) NATA CASSEL ANNO CHRISTI MDXXIX DIE XXV /
OCTO(BRIS) PRINCEPS PIETATE CASTITATE ET BENEFICENTIA IN
PAVPERES IN=/CLYTA CVM MARITO SVO WOLFGANGO PALA(TINO)
RHENI XXIIII ANNIS IN CONIV=/GIO VIXIT V FILIOS ET VIII
FILIAS ENIXA HORVM X AD MATVRAM AETATEM / PIE EDVCAVIT ET
DE VI EORVM CONIVGIO ET NVMEROSA PROLE LAETATA EST
RE=/LIQ(VI)S PARTIM IN INFANTIA MORTVIS PARTIM ADHVC
INNVPTIS POST MARITI OBI=/ TVM XXII ANNOS IN VIDVITATE
HONORIFICE TRANSEGIT PAVPERES HV=/IVS LOCI SICVT ET
NEOBVRGI AC BIPONTI LIBERALITER DOTAVIT TAN=/DEM AETATE
ET ANNIS CONSVMTA CONSCRIPTO TESTAMENTO PIE IN / CHRISTO
IN HVIVS LOCI ARCE OBDORMIVIT ANNO DOM(INI) M D XCI DIE /
X MEN(SES) IVLII CVM VIXISSET IN HVIVS MVNDI AERVMNIS
ANNOS LXI MEN(SES) / VIII DIES XV CVIVS CORPVS
MOESTISSIMORVM LIBERORVM ET NEPOTVM PIE=/ TATE IN HOC
SEPVLCHRVM AD MARITVM EST COLLOCATVM CVM OM=/NIBVS IN
CHRISTVM CREDENTIBVS LAETAM RESVRECTIONEM MOR=/TVORVM AD
VITAM AETERNAM EXPECTANS AMEN". Das bedeutet: Anna
Pfalzgräfin bei Rhein, Tochter des Landgrafen Philipp d.
Ä. von Hessen und der Herzogin Christine von Sachsen,
wurde in Kassel am 25. Oktober geboren im Jahre Christi
1529. Sie war eine wegen ihrer Frömmigkeit,
Sittenreinheit und Wohltätigkeit den Armen gegenüber
berühmte Fürstin. Mit ihrem Ehemann Wolfgang Pfalzgraf
bei Rhein hat sie 24 Jahre lang in der Ehe gelebt und
dabei fünf Söhne und acht Töchter geboren. Zehn von
ihnen erzog sie fromm, bis sie erwachsen waren, und wurde
durch die Vermählung von sechs derselben und ihre
zahlreiche Nachkommenschaft erfreut, die übrigen starben
zum Teil im Kindesalter, zum Teil sind sie bis jetzt
unvermählt geblieben. Nach dem Tode ihres Gatten
verbrachte sie 22 Jahre lang im ehrenvollen Witwenstand.
Die Armen dieses Ortes wie auch die in Neuburg und
Zweibrücken hat sie freigiebig unterstützt. Zuletzt ist
sie nach der Abfassung eines Testamentes durch Alter und
Jahre erschöpft fromm in Christus im Schloß dieses
Ortes am 10. Tag des Monats Juli entschlafen im Jahre des
Herrn 1591, nachdem sie in diesem Jammertal 61 Jahre, 8
Monate und 15 Tage verbracht hatte. Ihr Leichnam wurde
von den höchstbetrübten Kindern und Enkeln in dieser
Gruft bei ihrem Gatten bestattet, mit allen an Christus
Glaubenden eine fröhliche Auferstehung von den Toten zum
ewigen Leben erwartend. Amen. Diese beiden großen, am
Sockel unter den Verstorbenen angebrachten
Schiefertafeln, die von einem Rollwerkrand eingefaßt
werden, werden durch eine Allegorie der Gerechtigkeit mit
einer Waage in der Linken voneinander getrennt.
Übersicht über Genealogie und Abstammung:
- Ludwig I. Pfalzgraf bei Rhein zu
Zweibrücken Herzog von Bayern (1424-19.7.1489),
vermählt mit Jeanne de Croy (-18.6.1504), der Tochter
von Antoine I. de Croy Comte de Porcean et de Guines
(-1475) und Margaretha von Lothringen-Vaudemont (-1521)
- Alexander Pfalzgraf bei Rhein
zu Zweibrücken Herzog von Bayern
(26.11.1462-1514), vermählt mit Margareta von
Hohenlohe-Waldenburg-Neuenstein
(30.7.1480-3.9.1522), der Tochter von Kraft VI.
von Hohenlohe-Waldenburg-Neuenstein und Helene
von Württemberg
- Ludwig II. Pfalzgraf
bei Rhein zu Zweibrücken Herzog von
Bayern (14.9.1502-3.12.1532), vermählt
mit Elisabeth von Hessen
(10.9.1503-4.1.1563), der Tochter von
Wilhelm I. Landgraf von Hessen
(4.7.1466-8.2.1515) und Anna von
Braunschweig-Wolfenbüttel (-16.5.1520)
- Wolfgang
Pfalzgraf bei Rhein zu
Zweibrücken Herzog von Bayern
(26.9.1526-11.6.1569), 1532 zu
Zweibrücken, 30.6.1557 Kauf der
"jungen Pfalz", 1559 zu
Neuburg und Sulzbach, 1566 zu
Sponheim, vermählt mit Anna von
Hessen (26.10.1529-1591), der
Tochter von Philipp I. Landgraf
von Hessen (13.11.1504-31.3.1567)
und Christina von Sachsen
(25.12.1505-15.4.1549)
- Ludwig II. Landgraf von Hessen
(1402-17.1.1458), vermählt mit Anna von Sachsen
(5.6.1420-17.9.1462), der Tochter von Friedrich I.
Kurfürst von Sachsen (11.4.1370-4.1.1428) und Katharina
von Braunschweig-Calenberg (-28.12.1442)
- Ludwig III. Landgraf von
Hessen (7.9.1438-8.11.1471), vermählt mit
Mathilde von Württemberg-Urach (-1495), der
Tochter von Ludwig I. Graf von Württemberg-Urach
(-1450) und Mechthild Pfalzgräfin bei Rhein
(7.3.1419-22.8.1482)
- Wilhelm II. Landgraf
von Hessen (29.3.1469-11.7.1509),
vermählt mit Anna von Mecklenburg
(14.9.1485-12.5.1525), der Tochter von
Magnus II. Herzog von
Mecklenburg-Schwerin (1441-20.11.1503)
und Sophia von Pommern-Wolgast
(-26.4.1504)
- Philipp I.
Landgraf von Hessen
(13.11.1504-31.3.1567), vermählt
mit Christina von Sachsen
(25.12.1505-15.4.1549), der
Tochter von Georg Herzog von
Sachsen (27.8.1471-15.2.1539) und
Barbara von Polen
(15.7.1478-15.2.1534)
- Anna
von Hessen
(26.10.1529-1591),
vermählt mit Wolfgang
Pfalzgraf bei Rhein zu
Zweibrücken Herzog von
Bayern
(26.9.1526-11.6.1569)
Herzog Wolfgang führte ein kriegerisches
Leben: Zunächst trat er in die Dienste des spanischen Königs.
Dann zog er im Auftrag des Kaisers 1566 gegen die Türken, doch
als sich nach dem Tod von Sultan Suleiman die türkischen Heere
zurückzogen, gab es nicht mehr viel für Wolfgang zu tun, und er
kehrte ohne größere Abenteuer oder Erfolge aus Ungarn zurück.
1568 brach der dritte Hugenottenkrieg aus, und daran nahm er
wiederum teil. Einzige Schwierigkeit: Jetzt kämpfte er für die
Protestanten, also mußte er erst seine vertraglichen Bindungen
an Spanien lösen. Nun verbündete er sich mit Prinz Wilhelm von
Oranien und den Hugenotten und zog gegen die Franzosen. Dafür
stellte er ein Heer von 6000 Reitern und drei Regimentern zu Fuß
auf, insgesamt mehr als 17000 Mann, ganz zu schweigen von der
nötigen Ausrüstung und Artillerie, und er zahlte das selbst aus
eigener Tasche, weil es schließlich in seinen Augen um eine
gerechte Sache ging. So viel gab sein Herzogtum nicht her,
vielmehr mußte er dafür Schulden aufnehmen. Dafür war er jetzt
selbst Kriegsunternehmer und nicht länger Söldner. 1569 nahm
Herzog Wolfgang La Charité ein, eine starke Festung. Doch seine
Gesundheit war angeschlagen, er hatte sich 1556 einen Beinbruch
zugezogen, der schlecht verheilt war, er soff zu viel, und dann
erwischte ihn ein Fieber, woran er im Alter von erst 43 Jahren
starb. Seine inneren Organe und sein Herz wurden am Ort seines
Todes in der Kirche von Nexon bestattet. Der Rest wurde zunächst
in einem Bleisarg in der Hugenotten-Kirche von Angoulême
beigesetzt. Erst 4 Monate nach seinem Tod erfuhren die
Meisenheimer Angehörigen von seinem Tod. Erst 1571 konnte man
die sterblichen Überreste über Cognac und La Rochelle auf dem
Seeweg mit zahlreichen Schwierigkeiten wie Sturm und Seeräubern
nach Lübeck überführen. Den Leichnam hatte man als
"Gewehre und Rüstungen" deklariert, damit ihn die
abergläubischen Seeleute überhaupt mitnahmen. In Lübeck wurde
die wahre Natur des Paketes offenbar, und es gab reichlich Streß
deswegen. Dann wurde der Leichnam über Lüneburg, Braunschweig,
Kassel und Hofheim nach Meisenheim gebracht, wo er dann
endgültig bestattet wurde.
Zum Verständnis der Ahnenprobe, seine
Eltern:
- (1) Ludwig II. Pfalzgraf bei Rhein zu
Zweibrücken Herzog von Bayern (14.9.1502-3.12.1532)
- (2) Elisabeth von Hessen
(10.9.1503-4.1.1563)
Seine Großeltern:
- (1) Alexander Pfalzgraf bei Rhein zu
Zweibrücken Herzog von Bayern (26.11.1462-1514)
- (3) Margareta von
Hohenlohe-Waldenburg-Neuenstein (30.7.1480-3.9.1522)
- (2) Wilhelm I. Landgraf von Hessen
(4.7.1466-8.2.1515)
- (4) Anna von
Braunschweig-Wolfenbüttel (-16.5.1520)
Seine Urgroßeltern:
- (1) Ludwig I. Pfalzgraf bei Rhein zu
Zweibrücken Herzog von Bayern (1424-19.7.1489)
- (5) Jeanne de Croy (-18.6.1504)
- (3) Kraft VI. von
Hohenlohe-Waldenburg-Neuenstein
- (7) Helene von Württemberg
- (2) Ludwig III. Landgraf von Hessen
(7.9.1438-8.11.1471)
- (6) Mathilde von Württemberg-Urach
(-1495)
- (4) Wilhelm II. Herzog von
Braunschweig-Wolfenbüttel (-7.7.1503)
- (8) Elisabeth zu Stolberg
Ihre Eltern:
- (1) Philipp I. Landgraf von Hessen
(13.11.1504-31.3.1567)
- (2) Christina von Sachsen
(25.12.1505-15.4.1549)
Ihre Großeltern:
- (1) Wilhelm II. Landgraf von Hessen
(29.3.1469-11.7.1509)
- (3) Anna von Mecklenburg
(14.9.1485-12.5.1525)
- (2) Georg Herzog von Sachsen
(27.8.1471-15.2.1539)
- (4) Barbara von Polen
(15.7.1478-15.2.1534)
Ihre Urgroßeltern:
- (1) Ludwig III. Landgraf von Hessen
(7.9.1438-8.11.1471)
- (5) Mathilde von Württemberg-Urach
(-1495)
- (3) Magnus II. Herzog von
Mecklenburg-Schwerin (1441-20.11.1503)
- (7) Sophia von Pommern-Wolgast
(-26.4.1504)
- (2) Albrecht Herzog von Sachsen
(31.7.1443-12.9.1500)
- (6) Sidonie von Kunstadt-Podiebrad
(1449-1.2.1510)
- (4) Kazimierz IV. Jagiellonczyk König
von Polen (30.11.1427-7.6.1492)
- (8) Elisabeth von Österreich
(-30.8.1505)
Hauptwappen oben: rechts Herzogtum
Pfalz-Zweibrücken, links Landgrafschaft Hessen
 |
|
 |
| Landgrafschaft
Hessen |
|
Hessen, Pfalz,
Mecklenburg und Polen |
Wappen der Ahnenprobe: Im gegenwärtigen
Zustand entspricht die Anordnung der Wappen der Ahnenprobe nur
zur Hälfte den Erwartungen:
- (1) Schwertseite, ganz oben
("Hohe(n)=/lohe") - unlogisch, Fehler!
- (1) Spindelseite, ganz oben
("Hessen") - korrekt positioniert
- (2) Schwertseite, zweiter Schild von
oben ("Hessen") - korrekt positioniert
- (2) Spindelseite, zweiter Schild von
oben ("Pfaltz") - unlogisch, Fehler!
- (3) Schwertseite, dritter Schild von
oben ("Sachs=/sen") - unlogisch, Fehler!
- (3) Spindelseite, dritter Schild von
oben ("Meckel(n)=burg") - unlogisch, Fehler!
- (4) Schwertseite, vierter Schild von
oben ("Brau(n)=schweig") - korrekt positioniert
- (4) Spindelseite, vierter Schild von
oben ("Poln") - korrekt positioniert
 |
|
 |
| Herzogtum
Braunschweig-Wolfenbüttel |
|
Herzogtum Sachsen |
Diese Anordnung ist das Ergebnis einer
fehlerhaften Restaurierung, bei der vier Täfelchen an der
falschen Stelle angebracht wurden. Korrekt müßte die Abfolge
wie folgt sein:
- (1) Schwertseite, ganz oben
("Pfaltz"), Herzogtum
Pfalz-Zweibrücken (wie oben)
- (1) Spindelseite, ganz oben
("Hessen"), Landgrafschaft Hessen
(Komponenten: Katzenelnbogen, Ziegenhain, Nidda, Diez,
Hessen)
- (2) Schwertseite, zweiter Schild von
oben ("Hessen"), Landgrafschaft Hessen
(Komponenten: Katzenelnbogen, Ziegenhain, Nidda, Diez,
Hessen)
- (2) Spindelseite, zweiter Schild von
oben ("Sachs=/sen"), Herzogtum Sachsen
(Rautenkranz)
- (3) Schwertseite, dritter Schild von
oben ("Hohe(n)=/lohe"), Grafschaft
Hohenlohe (wie oben)
- (3) Spindelseite, dritter Schild von
oben ("Meckel(n)=burg"), Herzogtum
Mecklenburg-Schwerin (Komponenten: Mecklenburg,
Stargard, Wenden, Rostock, Schwerin)
- (4) Schwertseite, vierter Schild von
oben ("Brau(n)=schweig"), Herzogtum
Braunschweig-Wolfenbüttel (Komponenten:
Braunschweig, Lüneburg, Everstein, Homburg)
- (4) Spindelseite, vierter Schild von
oben ("Poln"), Königreich Polen
(in Rot ein silberner Adler)
Karl
Pfalzgraf bei Rhein zu Zweibrücken-Birkenfeld Herzog von Bayern
Dieses monumentale Epitaph mißt ca. 8,10 m in der Höhe und 3,00
m in der Breite. Es ist rechterhand an der Südwand der
Grabkapelle angebracht, nach der Gittertür zum Seitenschiff
gleich rechterhand. der Sockel läuft unten spitz zu und erreicht
mit einer Maskenstütze den Boden. Es ist eine Arbeit aus
weißgelbem Sandstein vom Typ einer Pilasterädikula, angefertigt
von Michell Henckhell aus Bergzabern. Das überaus reich
dekorierte Epitaph wird dominiert von einer großen und tiefen
Figurennische mit einer freistehenden Plastik des Verstorbenen.
Er steht hier breitbeinig, dominant und frei wie ein großer
Krieger, was er eigentlich gar nicht war. Doch als die Franzosen
ihn während der Besetzung Meisenheims so sahen, hielten sie ihn
für einen großen Feldherrn und verschonten das Kunstwerk von
ihrem Vandalismus. Tatsächlich war er ein hochgebildeter
Herrscher mit starken geistigen, insbesondere theologischen
Interessen, der Schloß Birkenfeld ausbaute und mit einer großen
Bibliothek versah, dem Grundstock der späteren Bibliotheca
Bipontina. Das Epitaph wurde Ende des 19. Jh. restauriert. Es
gibt mehrere Inschriften am Epitaph, golden auf schwarz
ausgemalten Flächen (diesmal kein echter Schiefer, sondern
diesen nur vortäuschend):
- in der Gebälkzone: "SI CREDIMVS
IESVM MORTVVM ESSE ET RESVRREXISSE / ITA ETIAM ET DEVS
EOS QVI OBDORMIERINT IN IE=/SV ADDVCET CVM EO THESS: CAP:
IIII" - wenn wir glauben, daß Jesus gestorben ist
und wiederauferstanden, so wird auch Gott diejenigen,
welche in Jesus entschlafen sind, mit sich (in das ewige
Leben) führen.
- die große Inschrift unter der
Figurennische enthält die biographischen Angaben:
"CAROLVS DEI GRATIA COMES PALATINVS RHENI DVX
BAVARIAE COMES VEL=/DENTIAE ET SPONHEIMII V FILIVS
WOLFGANGI COMITIS PALA=/TINI RHENI & C(ETERA) ET
ANNAE LANDGRAVIAE HASSIAE & NATVS NE=/OBVRGI AD
DANVBIVM ANNO CHRISTI MDLX DIE IV SEPTE(M)=/BRIS IN
PIETATE ET BONIS MORIBVS AB INFANTIA EDVCATVS / IVVENILEM
VITAM IN AVLIS PALATINA SAXONICA ET BRAN=/DENBVRGENSI
TRANSEGIT WILHELMI DVCIS BRAVNSCHW=/GENSIS ET
LVNENBVRGENSIS & C(ETERA) ET DOROTHEAE REGINAE
DAN=/NIAE & C(ETERA) FILIAE DOROTEAE MATRIMONIO
IVNCTVS EX EA / TRES FILIOS ET VNAM FILIAM PROCREAVIT ET
SVPERSTITES / RELIQVIT COMITATVM SPONHEIMENSEN XVI ANNOS
/ PIE IVSTE PRVDENTER ET PACIFICE ADMINISTRAVIT TAN=/DEM
MORBO CORREPTVS HANC MORTALEM VITAM CVM= / COELESTI ET
AETERNA GLORIA PER VERAM FIDEM IN CHRI/STVM COMMVTAVIT ET
PIE OBIIT IN ARCE BIRCKENFELD / DIE VI DECEMBRIS ANNO
CHRISTI MDC INDE TRANSLA=/TVS EIVSDEM MENSIS DIE XVIII
HIC HONORIFICE SEPVL/TVS LOETAM RESVRRECTIONEM A MORTVIS
AD VITAM AE=/TERNAM CVM OMNIBVS IN CHRISTVM CREDENTIBVS
EXPECTAT / M(OESTISSIMA) C(ONIVX) L(IBERI) E(T) F(RATRES)
F(IERI) C(VRAVERVNT) D(EO) O(PTIMO) M(AXIMO)
S(ACRVM)". Das bedeutet: Karl von Gottes Gnaden
Pfalzgraf bei Rhein, Herzog in Bayern, Graf zu Veldenz
und Sponheim, fünfter Sohn von Wolfgang Pfalzgraf bei
Rhein etc., und der Anna Landgräfin von Hessen etc.,
geboren zu Neuburg an der Donau am 4. September im Jahre
Christi 1560, wurde in Frömmigkeit und in guten Sitten
von Kindheit an erzogen. Seine Jugendzeit verbrachte er
am pfälzischen, sächsischen und brandenburgischen
Fürstenhof. Er war vermählt mit Dorothea, der Tochter
des Herzogs Wilhelm von Braunschweig und Lüneburg etc.,
und der Dorothea königliche Prinzessin von Dänemark,
und zeugte mit ihr drei Söhne und eine Tochter, die ihn
allesamt überlebten. Die Grafschaft Sponheim regierte er
16 Jahre lang fromm, gerecht, klug und friedlich. Von
einer Krankheit wurde er schließlich hinweggerafft,
tauschte durch seinen wahren Glauben an Christus dieses
vergängliche Leben gegen die himmlische und ewige
Herrlichkeit ein und verschied fromm auf dem Schloß
Birkenfeld am 6. Dezember des Jahres Christi 1600. Von
dort aus wurde er am 18. Tag desselben Monats hierhin
überführt und ehrenvoll bestattet. Er erwartet mit
allen an Christus Glaubenden eine fröhliche Auferstehung
von den Toten zum ewigen Leben. Die tiefbetrübte Gattin,
Kinder und Brüder haben dieses, dem besten und höchsten
Gott geweihte (Grabmonument) errichten lassen. Für die
stark abgekürzte letzte Zeile ist auch die
Interpretation M(OESTISSIMA) C(ONIVX) L(IBERI) E(T)
F(RATRES) F(ECERVNT) C(OLLOCARI) D(EO) O(PTIMO) M(AXIMO)
S(ACRVM) möglich, was letztlich auf die gleiche
Bedeutung hinausläuft.
- In der Sockelzone befindet sich noch
eine Inschrift, die wohl ein persönliches Motto
darstellt: "SIS SAPIENS ET SIS PATIENS. DICENDO
SILENDO QVI SAPIT ET PATITVR DENIQVE VICTOR ERIT",
was soviel bedeutet wie: Im Reden sei weise und im
Schweigen sei geduldig, denn wer Weisheit und Geduld
besitzt, wird letztendlich Sieger sein.
Übersicht über Genealogie und Abstammung:
- Alexander Pfalzgraf bei Rhein zu
Zweibrücken Herzog von Bayern (26.11.1462-1514),
vermählt mit Margareta von
Hohenlohe-Waldenburg-Neuenstein (30.7.1480-3.9.1522), der
Tochter von Kraft VI. von Hohenlohe-Waldenburg-Neuenstein
und Helene von Württemberg
- Ludwig II. Pfalzgraf bei Rhein
zu Zweibrücken Herzog von Bayern
(14.9.1502-3.12.1532), vermählt mit Elisabeth
von Hessen (10.9.1503-4.1.1563), der Tochter von
Wilhelm I. Landgraf von Hessen
(4.7.1466-8.2.1515) und Anna von
Braunschweig-Wolfenbüttel (-16.5.1520)
- Wolfgang Pfalzgraf bei
Rhein zu Zweibrücken Herzog von Bayern
(26.9.1526-11.6.1569), 1532 zu
Zweibrücken, 30.6.1557 Kauf der
"jungen Pfalz", 1559 zu Neuburg
und Sulzbach, 1566 zu Sponheim, vermählt
mit Anna von Hessen (26.10.1529-1591),
der Tochter von Philipp I. Landgraf von
Hessen (13.11.1504-31.3.1567) und
Christina von Sachsen
(25.12.1505-15.4.1549)
- Karl
Pfalzgraf bei Rhein zu
Zweibrücken-Birkenfeld Herzog
von Bayern
(4.9.1560-6.12.1600), Begründer
der Birkenfelder Linie, direkter
Vorfahr des bayerischen
Königshauses, 1569 zu
Birkenfeld, 1584 Ererbung von
Hinter-Sponheim mit Birkenfeld,
vermählt 1586 in Celle mit
Dorothea von
Braunschweig-Lüneburg-Celle
(1.1.1570-15.8.1649), der Tochter
von Wilhelm V. Herzog von
Braunschweig-Lüneburg-Celle
(4.7.1535-1592) und Dorothea von
Dänemark (1546-1617)
- Georg
Wilhelm Pfalzgraf bei
Rhein zu
Zweibrücken-Birkenfeld
Herzog von Bayern
(26.8.1591-25.12.1669),
vermählt in erster Ehe
am 30.11.1616 in
Neuenstein mit Dorothea
Gräfin zu
Solms-Sonnenwalde und
Pouch (1586-5.9.1625), in
zweiter Ehe am 31.10.1641
auf Schloß Birkenfeld
mit Juliane Wild- und
Rheingräfin von
Salm-Grumbach (1616-) und
in dritter Ehe am
7.3.1649 auf Schloß
Hartenburg mit Anna
Elisabeth Gräfin von
Oettingen-Oettingen
(3.11.1603-3.6.1673),
Nachkommen
- Sophia
Pfalzgräfin bei Rhein zu
Zweibrücken-Birkenfeld
(29.3.1593-16.11.1676),
vermählt 1615 in
Neuenstein mit Kraft VII.
Graf von
Hohenlohe-Neuenstein-Weikersheim
und Gleichen
(14.11.1582-11.10.1641),
Nachkommen
- Friedrich
Pfalzgraf bei Rhein zu
Zweibrücken-Birkenfeld
(29.10.1594-20.7.1626),
unvermählt und kinderlos
- Christian
I. Pfalzgraf bei Rhein zu
Birkenfeld-Bischweiler
Herzog von Bayern
(3.9.1598-6.9.1654),
vermählt in erster Ehe
am 14.11.1630 in
Zweibrücken mit
Magdalena Katharina
Pfalzgräfin bei Rhein zu
Zweibrücken
(26.4.1607-10.1.1648) und
in zweiter Ehe 1648 in
Bischweiler mit Maria
Johanna Gräfin von
Helfenstein-Wiesensteig
(8.9.1612-20.8.1665),
Nachkommen
Zum Verständnis der Ahnenprobe, Eltern:
- (1) Wolfgang Pfalzgraf bei Rhein zu
Zweibrücken Herzog von Bayern (26.9.1526-11.6.1569)
- (2) Anna von Hessen (26.10.1529-1591)
Großeltern:
- (1) Ludwig II. Pfalzgraf bei Rhein zu
Zweibrücken Herzog von Bayern (14.9.1502-3.12.1532)
- (3) Elisabeth von Hessen
(10.9.1503-4.1.1563)
- (2) Philipp I. Landgraf von Hessen
(13.11.1504-31.3.1567)
- (4) Christina von Sachsen
(25.12.1505-15.4.1549)
Urgroßeltern:
- (1) Alexander Pfalzgraf bei Rhein zu
Zweibrücken Herzog von Bayern (26.11.1462-1514)
- (5) Margareta von
Hohenlohe-Waldenburg-Neuenstein (30.7.1480-3.9.1522)
- (3) Wilhelm I. Landgraf von Hessen
(4.7.1466-8.2.1515)
- (7) Anna von
Braunschweig-Wolfenbüttel (-16.5.1520)
- (2) Wilhelm II. Landgraf von Hessen
(29.3.1469-11.7.1509)
- (6) Anna von Mecklenburg
(14.9.1485-12.5.1525)
- (4) Georg Herzog von Sachsen
(27.8.1471-15.2.1539)
- (8) Barbara von Polen
(15.7.1478-15.2.1534)
Zwei Hauptwappen oben für die Eltern:
heraldisch rechts Herzogtum Pfalz-Zweibrücken,
geviert aus Pfalz und Wittelsbach, Herzschild Veldenz, zwei
Helme, Löwe zwischen Büffelhörnern und Löwe zwischen Flug,
heraldisch links: Landgrafschaft Hessen, mit
allen drei Helmen für Hessen, Katzenelnbogen und Ziegenhain.
Wappen der Ahnenprobe:
- (1) Schwertseite, ganz oben
("PFALTZ"), Herzogtum
Pfalz-Zweibrücken (wie oben)
- (2) Spindelseite, ganz oben
("HESSEN"), Landgrafschaft Hessen
(Komponenten: Katzenelnbogen, Ziegenhain, Nidda, Diez,
Hessen)
- (3) Schwertseite, zweiter Schild von
oben ("HESSEN"), Landgrafschaft Hessen
(Komponenten: Katzenelnbogen, Ziegenhain, Nidda, Diez,
Hessen)
- (4) Spindelseite, zweiter Schild von
oben ("SACHSEN"), Herzogtum Sachsen
(Rautenkranz)
- (5) Schwertseite, dritter Schild von
oben ("HOHENLOHE"), Grafschaft
Hohenlohe (wie oben)
- (6) Spindelseite, dritter Schild von
oben ("MECKELB/=VRG"), Herzogtum
Mecklenburg (Komponenten: Mecklenburg, Stargard,
Wenden, Rostock, Schwerin)
- (7) Schwertseite, vierter Schild von
oben ("BRVNSCH/WEIG"), Herzogtum
Braunschweig (Komponenten: Braunschweig,
Lüneburg, Everstein, Homburg)
- (8) Spindelseite, vierter Schild von
oben ("POLEN"), Königreich Polen
(in Rot ein silberner Adler)
Literatur,
Links und Quellen:
Lokalisierung auf Google Maps:
https://www.google.de/maps/@49.7052288,7.671852,19z?entry=ttu - https://www.google.de/maps/@49.7052213,7.671827,72m/data=!3m1!1e3?entry=ttu
Karl-Heinz Drescher und Günther Lenhoff: Die Schloßkirche zu
Meisenheim, Rheinische Kunststätten, Heft 465, hrsg. vom
Rheinischen Verein für Denkmalpflege und Landschaftsschutz,
Köln/Neuß, 1. Auflage 2002, ISBN 3-88094-882-8
1504-2004 Schloßkirche Meisenheim, bewegende Geschichte und
lebendige Gegenwart eines einzigartigen Bauwerks, hrsg. von der
Evangelischen Kirchengemeinde Meisenheim, Meisenheim 2003/2004,
ISBN 3-00-011685-0, mit Beiträgen von Günter Anthes, Gustav
Adolf Benrath, Otto Böcher, Hans Böker, Klaus Freckmann, Karen
Groß, Martin Held, Günther Lenhoff, Karlheinz Nestle, Eberhard
Nikitsch, Walter Rödel, Wolfgang Schmid, Werner Schnuchel und
Rainer Voss.
Evangelische Johanniter-Kirchengemeinde: https://nahe-glan.ekir.de/inhalt/johanniter-gemeinde-bva/
evangelische Schloßkirche auf der Webseite der Stadt: http://www.stadt-meisenheim.de/historie/evangelische-schlosskirche/
Christine Pfalzgräfin bei Rhein zu Zweibrücken-Neuburg:
Deutsche Inschriften Bd. 34, Bad Kreuznach, Nr. 496 (Eberhard J.
Nikitsch), in: www.inschriften.net,
urn:nbn:de:0238-di034mz03k0049609 - https://www.inschriften.net/landkreis-bad-kreuznach/inschrift/nr/di034-0496.html
Friedrich Pfalzgraf bei Rhein zu Zweibrücken-Landsberg: Deutsche
Inschriften Bd. 34, Bad Kreuznach, Nr. 489 (Eberhard J.
Nikitsch), in: www.inschriften.net,
urn:nbn:de:0238-di034mz03k0048904 - https://www.inschriften.net/landkreis-bad-kreuznach/inschrift/nr/di034-0489.html
Anna Pfalzgräfin bei Rhein zu Zweibrücken-Neuburg: Deutsche
Inschriften Bd. 34, Bad Kreuznach, Nr. 341 (Eberhard J.
Nikitsch), in: www.inschriften.net,
urn:nbn:de:0238-di034mz03k0034104 - https://www.inschriften.net/landkreis-bad-kreuznach/inschrift/nr/di034-0341.html
Wolfgang Pfalzgraf bei Rhein zu Zweibrücken Herzog von Bayern
und Anna von Hessen: Deutsche Inschriften Bd. 34, Bad Kreuznach,
Nr. 340 (Eberhard J. Nikitsch), in: www.inschriften.net,
urn:nbn:de:0238-di034mz03k0034006 - https://www.inschriften.net/landkreis-bad-kreuznach/inschrift/nr/di034-0340.html
Karl Pfalzgraf bei Rhein zu Zweibrücken-Birkenfeld Herzog von
Bayern: Deutsche Inschriften Bd. 34, Bad Kreuznach, Nr. 438
(Eberhard J. Nikitsch), in: www.inschriften.net,
urn:nbn:de:0238-di034mz03k0043809 - https://www.inschriften.net/landkreis-bad-kreuznach/inschrift/nr/di034-0438.html
Genealogien: Prof. Herbert Stoyan, Adel-digital, WW-Person auf
CD, 10. Auflage 2007, Degener Verlag ISBN 978-3-7686-2515-9
Verwendung der Innenaufnahmen mit freundlicher Erlaubnis von Herrn Richard Held vom
16.1.2025, wofür ihm und dem
Presbyterium der Johanniter-Gemeinde an dieser Stelle herzlich
gedankt sei.

die evangelische Schloßkirche in
Meisenheim - ev.
Schloßkirche: Amtmann Daniel von Merlau und seine Frau - ev. Schloßkirche:
Margaretha von Schwarzenberg - ev. Schloßkirche:
Johann Philipp Boos von Waldeck - ev. Schloßkirche:
Anton Boos von Waldeck
- ev. Schloßkirche: Simon III. Boos von
Waldeck - ev.
Schloßkirche: Sebastian Werner von Kellenbach und Waldburg
Marschall von Waldeck
- ev. Schloßkirche: die Kinder des
Friedrich von Castiglion - ev. Schloßkirche:
Catharina von Bernstein/Bärenstein - ev. Schloßkirche:
Johann Daniel und Carl Ludwig Schmidtmann - ev. Schloßkirche:
Dorothea Ursula von Steinkallenfels und ihre Tochter, Juliana
Magdalena von Kötteritz
Haus Nassau - ottonische Hauptlinie - Haus Nassau - walramsche Hauptlinie
Wappen, Linien und Territorien der
Welfen (1): Wappen-Komponenten und ihre Geschichte
Wappen, Linien und Territorien der
Welfen (2): Entwicklung der herzoglichen Wappen
Die Entwicklung des Hessischen Wappens - Wappen der Wittelsbacher (1): Pfalz
Wappen des gräflichen und fürstlichen
Hauses Stolberg - Die Wappen des Hauses Hohenlohe
Die Wappen der Markgrafen, Kurfürsten und
Großherzöge von Baden
Sächsische Wappen (1), Ernestinische
Linie - Sächsische Wappen (2), Albertinische Linie
Die Entwicklung des Wappens der Rhein-
und Wildgrafen und Fürsten zu Salm
Ortsregister - Namensregister - Regional-Index
Zurück zur Übersicht Heraldik
 Home
Home
©
Copyright / Urheberrecht an Text, Graphik und Photos: Bernhard
Peter 2025
Impressum
![]()
![]()





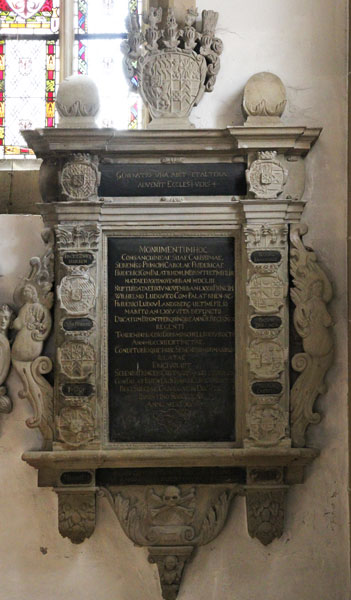



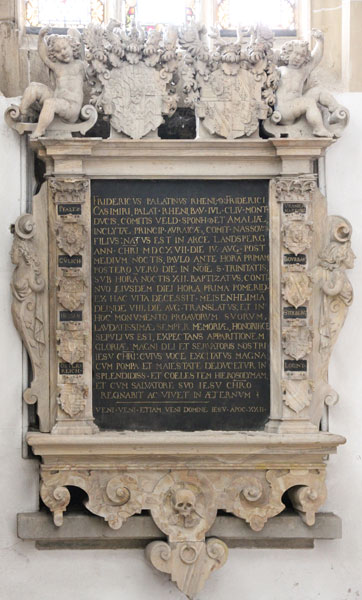












![]()