Einführung in die Heraldik: Schildteilungen und Rangordnung der Felder
Aus vielen Gründen nahm die Komplexität der Wappen im Laufe der Geschichte zu:
Damit stand man vor drei Problemen:
Regeln für die Wichtigkeit der Bestandteile:
Regeln zum Einsortieren bzw. Ansprechen der einzelnen Bestandteile und Felder:
Regeln zur Blasonierung komplexer Wappen:
Die
Rangordnung im einzelnen:
Die Nummerierung der Felder
dient nicht nur der Erzeugung einer Rangfolge und Reihenfolge
beim Blasonieren, sondern auch der gezielten Ansprache von
Positionen, wie z. B.: "golden-schwarz-schräggeviert, in
Feld 1 ein Stern", oder "achtfach geständert, in Platz
1 eine Kugel". Die Rangfolge der Felder entscheidet auch
darüber, wo eine gegebene Farbe hingehört, so ist die zuerst
genannte Farbe die höherrangige, also bei "schräggeviert
von Rot und Gold" beinhaltet automatisch Rot = 1, Gold = 2,
und damit auch Gold = 3 und Rot = 4.
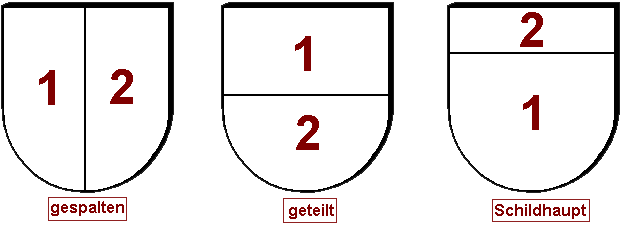
Wenn man nur Spaltungen hat, zählt man die Felder oder Plätze einfach von heraldisch rechts nach heraldisch links durch. Wenn man nur Teilungen hat, zählt man die Felder oder Plätze einfach von oben nach unten durch. Eine Sonderstellung hat das Schildhaupt, das ist nachgeordnet, weil es als Modifizierung oder Ergänzung eines bestehenden Hauptwappens angesehen wird und historisch meistens eine differenzierende Zutat war.
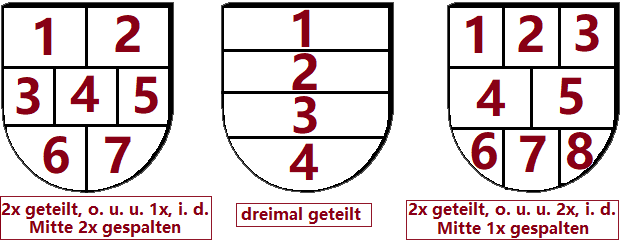
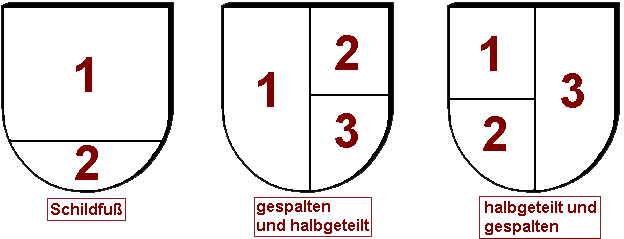
Bei "halbgeteilt und gespalten" gibt es unterschiedliche Ansichten. Nach den obigen Regeln müßte es wie in der nachfolgenden Abbildung unten links angesprochen werden, denn das ungeteilte Feld stößt oben auf ganzer Breite an und hätte Anrecht auf die Zählung "2". Dem folgt z. B. Leonhard in seinem Standardwerk. Die WBO macht sich hingegen eine andere Ansicht zu eigen und bezeichnet das große Feld mit "3", wie in der Abbildung oben rechts. Das ist nicht logisch und entspricht nicht den eingangs genannten Regeln, ist aber vermutlich von der Absicht geleitet, den Fall analog zu "gespalten und halbgeteilt" zu behandeln, also symmetrisch. Oder man ließ sich von der Reihenfolge der Nennung der Teilungen leiten, erst halbgeteilt, dann gespalten. Wo wie hier mehrere Ansichten von Gewicht und Relevanz existieren, ist es ratsam, zusätzlich präzisierende Angaben zu machen, damit es eindeutig ist.
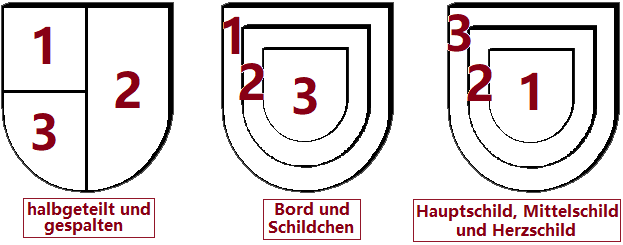
Es gibt noch andere Fälle, die nicht eindeutig sind. In der obigen Graphik sind in der Mitte und rechts exakt die gleichen Aufteilungen. Handelt es sich um EIN Wappen, dann sind die Schildteilungen graphische Untereinheiten, und die Ansprache-Reihenfolge folgt der obigen Regel, daß das oberste zuerst kommt. Hier trifft man von oben kommend zuerst auf den Bord, dann auf das Feld, und zuletzt auf das Schildchen. Entsprechend würde man blasonieren: "Innerhalb eines roten Bordes in Gold ein blaues Schildchen" o.ä. Handelt es sich aber um ein zusammengesetztes Wappen, also um mehrere "gestapelte" Wappen, dann sind die Grenzen logische Untereinheiten. Ein Beispiel ist ein Mann aus einer Familie mit Stammwappen auf einem Rückschild mit weiteren Ansprüchen, der zudem Fürstbischof war. Es sind also nicht Felder, sondern mehrere Schilde als historisch gewachsene Kombination. Dann gilt nicht die reihenweise Ordnung, sondern die klassenweise Ordnung, das wichtigste zuerst, und da ist der Herzschild die Nr. 1, gefolgt vom Mittelschild, gefolgt vom Hauptschild als Nr. 3. Welche Reihenfolge gilt, hängt also vom Kontext ab.
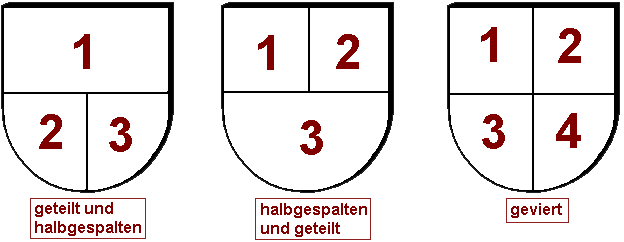
Wenn Spaltungen und Teilungen zusammen eine Schildfläche untergliedern, folgen wir der reihenweise Ordnung. Das heißt, daß die Regel "oben vor unten" übergeordnet ist, und die Regel "rechts vor links" da hineingeschachtelt wird: Alles auf der selben Höhe wird reihenweise durchgezählt, und erst wenn man damit fertig ist, springt man in die nächste Reihe und macht dort das Gleiche.
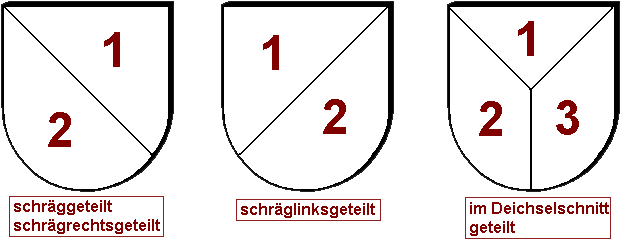
Auch bei schrägen Teilungen gilt die obige Grundregel. Das Feld, das mehr Kontakt zur Schildoberkante hat bzw. dessen geometrischer Mittelpunkt (optischer Schwerpunkt) weiter oben liegt, genießt Priorität. Sind zwei Felder hinsichtlich dieser Eigenschaften gleichwertig, gilt "rechts vor links".
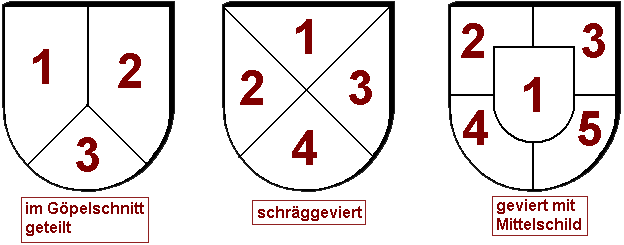
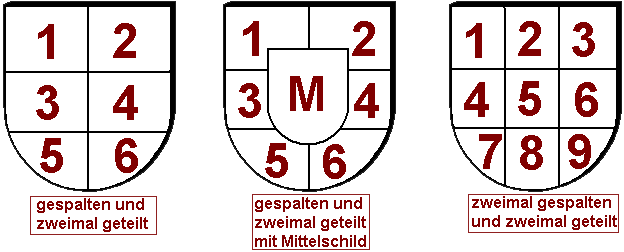

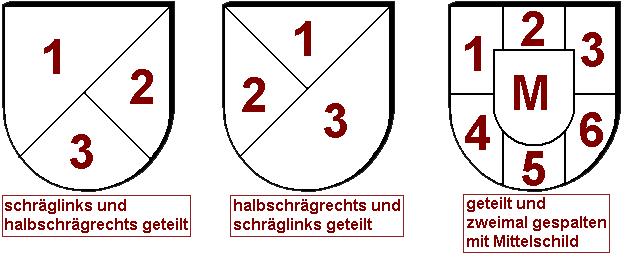
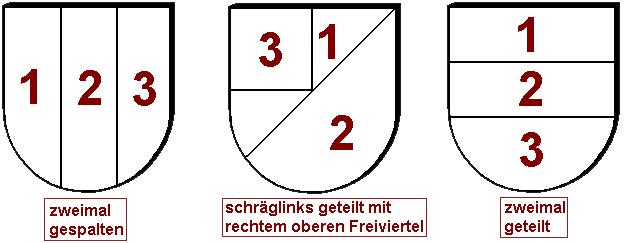
Ein interessanter Fall betrifft Oberecken und Freiviertel. Sie werden genau wie Schildhäupter oder Schildfüße als nachgeordnete Abteilungen angesehen. Beim Schildfuß macht das keinen Unterschied, weil es sowieso unten ist. Bei Schildhäuptern, Freivierteln und Oberecken jedoch ist der Platz eindeutig oben, und man könnte versucht sein, das als "1" anzusprechen. Tatsächlich hat sich aber historisch eine andere Ansprache-Reihenfolge herausgebildet, erst die Hauptteilung des Feldes, entsprechend die Zahlenvergabe, und zuletzt die abgetrennte Fläche. das ist vermutlich historisch begründet, weil Schildhäupter und Oberecken und Freiviertel häufig der Wappendifferenzierung dienten, also eine Änderung eines bestehenden Wappens darstellten. Daher geht man wie beim Originalwappen vor und nennt danach die variierende Komponente. Natürlich gibt es auch hier Ausnahmen, die von Anfang an nur mit Freiviertel vorkamen, wie z. B. die von Vellberg. Aber auch dort ist die Sichtweise, daß einem "fertigen" Wappen das Freiviertel nachträglich aufgelegt wird.
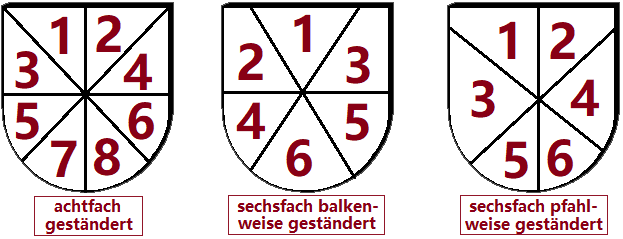
Bei Ständerungen hängt es von der Lage ab. Gibt es eine vertikale Spiegelebene, dann haben wir paarweise gleichhohe Felder. Innerhalb jeder Gruppe gleich hoher Felder arbeiten wir von heraldisch rechts nach links die Paare ab. Gibt es dagegen keine vertikale Spiegelebene, dann sind jeweils das oberste und das unterste Feld in einer Höhe für sich allein. Das Feld, das mit seinem optischen Schwerpunkt am höchsten liegt innerhalb der Schildfläche, ist das oben in der Mitte. Es hat als einziges zwei Begrenzungslinien, die beide an den oberen Schildrand stoßen. Deshalb ist es als "1" anzusprechen. Dann folgen paarweise die übrigen Felder, weil immer zwei auf einer Höhe liegen. Das letzte Feld unten in der Mitte hat wieder eine Einzelstellung, weil sein Schwerpunkt unterhalb demjenigen aller anderen Felder liegt. Es bekommt damit die höchste Zahl der Zählung.
©
Copyright Text, Graphik und Photos: Bernhard Peter 2004, 2006,
2025
Impressum